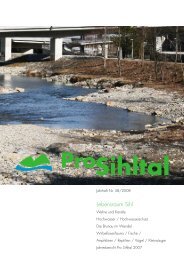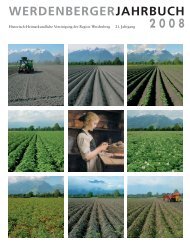Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
und 30 Liter zu fassen. Der Verdauungstrakt ist auf schwer<br />
verdauliche Zellulosenahrung eingerichtet. Eingetrocknete,<br />
mit Haaren verfilzte Bestandteile bilden im Labmagen<br />
gelegentlich die sogenannten Bezoar kugeln, ovale, leicht<br />
abgeflachte Gebilde. Diesen wie auch den Lungen, Herzknochen<br />
(verknöcherten Sehnen der Herzmuskulatur), den<br />
Hörnern und anderen Körperteilen wur den früher Heilkräfte<br />
zugeschrieben, was hauptsächlich zur Beinaheausrottung<br />
dieser Wildart beigetragen hat.<br />
Verbreitung<br />
Die heutige Verbreitung des Alpensteinbockes umfasst den gesamten<br />
Alpenbogen von den südfranzösischen Alpen über die<br />
Schweiz, Norditalien, <strong>Liechtenstein</strong>, Österreich und Slowenien.<br />
Bis zum 19. Jahrhundert führte die übermässige Bejagung zur<br />
Beinahe-Ausrottung dieser Tierart. Nur im Gebiet des heutigen<br />
Nationalparks Gran Paradiso in Italien überlebte unter dem<br />
Schutz des damaligen Königs eine Population, von deren<br />
Grösse keine genauen Überliefe rungen vorliegen. Ab 1906<br />
erfolgten die ersten Lieferungen von Steinkitzen aus diesem<br />
Gebiet in die Schweiz in den St. Galler Tierpark «Peter und<br />
Paul» – auf nicht immer offi ziel len Wegen. 1911 erfolgte mit<br />
zwei Böcken und drei Geissen die erste Koloniegründung der<br />
Abb. 208 Das Verbreitungsgebiet des Alpensteinbocks<br />
beschränkt sich auf das Gebiet zwischen Mittagsspitze und<br />
Naafkopf.<br />
2 1 0Kilometer<br />
Schweiz im Gebiet «Graue Hörner» im St. Gallischen Weisstannental<br />
(MEILE ET AL. 2003). Ab 1920 konnten die ersten<br />
Steinböcke innerhalb der Schweiz eingefangen und in andere<br />
Gebiete versetzt wer den. Die in <strong>Liechtenstein</strong> vorkommenden<br />
Steinböcke sind Tiere aus der bündnerischen Falkniskolonie.<br />
Diese wurde durch verschie dene Aussetzungen zwischen 1958<br />
und 1972 im angren zen den Graubünden und Vorarlberg begründet.<br />
Im ersten Bericht der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft<br />
<strong>Liechtenstein</strong>-Sargans-Werdenberg wurden unab hän gig<br />
von einander die ersten Exemplare auf <strong>Liechtenstein</strong>er Boden<br />
gemeldet und zwar durch Andreas Frommelt, Vaduz (zwei<br />
Exemplare am 13.8.1971) und Walter Wachter, Schaan (vier bis<br />
sechs Exemplare ca. drei Wochen vorher) (BZG-Bericht 1971).<br />
Vor allem im Sommer steht ein Teil der Falknispopulation<br />
auf <strong>Liechtenstein</strong>er Gebiet zwischen Mittagspitz und Naafkopf.<br />
Das übrige Berggebiet <strong>Liechtenstein</strong>s ist wenig geeignet<br />
als Steinwildlebensraum. Im Herbst 1989 wurde zum<br />
ersten Mal ein Steinbock auf der offiziellen Jagd in <strong>Liechtenstein</strong><br />
(Lawenatal) erlegt. Seither erfolgt die Bestandser fas -<br />
sung und Abschussplanung in Absprache mit den Behörden<br />
des Kantons Graubünden.<br />
Lebensraum<br />
Im Sommer hält sich das Steinwild gerne in Hochgebirgsgegenden<br />
auf, die eine weit hinaufreichende Zone alpiner<br />
Matten und schutzbietender Felsgebiete aufweisen. Diese<br />
Lebensraumqualitäten müssen möglichst grossräumig vorhanden<br />
sein und den Zusammenschluss zwischen benachbar -<br />
ten Populationen ermöglichen und optimalerweise zwischen<br />
2500 und 3000 m ü. M. liegen. Für diese Qualitäten eignet<br />
sich in <strong>Liechtenstein</strong> gerade noch die nördliche Gebirgskette<br />
am Falknis. Liegen die Steinwildgebiete unterhalb dieser<br />
Höhe wird der alpine Weidegürtel bis zur Waldgrenze hinab<br />
zu schmal und es entsteht eine Konkurrenz mit dem Alpvieh<br />
und den Gämsen. Die Wintereinstände liegen in der Regel in<br />
tieferen Lagen als die Sommereinstände. Im Winter überlebt<br />
das Steinwild vor allem durch das Einsparen von Energie,<br />
wofür ruhige, nach Süden exponierte Flanken erforderlich<br />
sind, an denen der Schnee schnell schmilzt oder abrutscht<br />
und immer Nahrung bereit hält und die gleichzeitig Wärme<br />
und Schutz bieten. Im ausapernden Frühjahr zieht das Stein -<br />
wild gerne in tiefer gelegene aufgelockerte Nadelwälder<br />
und Maiensässe und zieht mit der zurückweichenden<br />
Schneegrenze hinauf in die Sommereinstände.<br />
Gefährdung und Schutzmassnahmen<br />
Steinwild wird in <strong>Liechtenstein</strong> zurückhaltend und in Absprache<br />
mit dem Kanton Graubünden bejagt. Die Falknispopulation<br />
ist nicht gefährdet und entwickelt sich gut.<br />
Aussetzungen von Steinwild in anderen Landesteilen wären<br />
auf grund ungeeigneter Lebensräume nicht sinnvoll.<br />
Durch die wissenschaftlich begründete Jagdplanung ist der<br />
Bestand des Steinwildes einfach zu regulieren.<br />
Michael Fasel<br />
173