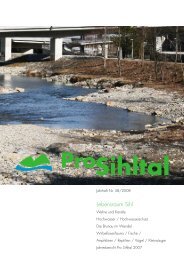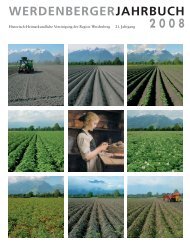Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ernst von Lehmann bezeichnete Prinz Hans von <strong>Liechtenstein</strong><br />
als tragenden Grund aller seiner Unternehmungen mit<br />
der Beschaffung von Wohn- und Fahrmöglichkeiten und<br />
Kenntnis der lokalen Gegebenheiten. Prinz Hans war damals<br />
Vorsitzender der <strong>Liechtenstein</strong>er Jägerschaft und veröffentlichte<br />
als erste zoologische Publikation 1954 eine Liste der<br />
Avifauna des Landes (FASEL 1994). Als Jäger standen für ihn<br />
die grösseren jagdbaren Tiere eher im Vordergrund der Betrachtung.<br />
Er erstellte für sich privat ein unveröffentlichtes<br />
Dossier von Aussagen über die Wildschwein-Invasion nach<br />
dem 2. Weltkrieg in <strong>Liechtenstein</strong> der Jahre 1947-1955.<br />
Das 1. Europäische Naturschutzjahr als Katalysator für die naturkundliche<br />
Forschung<br />
Im 1. Europäischen Naturschutzjahr 1970 des Europarates<br />
wurde die Botanisch-Zoologische Gesellschaft <strong>Liechtenstein</strong>-<br />
Sargans-Werdenberg e.V. gegründet. Sie sorgte in Zusammenarbeit<br />
mit der zuständigen Amtstelle des Landes dafür,<br />
dass <strong>Liechtenstein</strong> nicht mehr weitgehend eine «weisse<br />
Landkarte» bezüglich der Erforschung der einheimischen<br />
Tier- und Pflanzenwelt verblieben ist. Davon konnte aber<br />
die Säugetier-Erforschung vorerst nicht in vollem Ausmass<br />
profitieren. Es verblieb bei wenigen weiteren Abklärungen.<br />
Im europäischen Naturschutzjahr 1970 wurde eine Schrift<br />
zur Sensibilisierung für den Natur- und Landschaftsschutz an<br />
jeden Haushalt geschickt. In diesem Bericht wurde auch ein<br />
Portrait des Fischotters als zoologische Rarität abgedruckt<br />
(BROGGI 1970). In den Folgejahren wurden einige Arbeiten<br />
mit direkten oder indirekten Hinweisen über Säugetier -<br />
vorkommen im Historischen Jahrbuch des Fürstentums<br />
<strong>Liechtenstein</strong> veröffentlicht, und zwar zur Fauna in den<br />
liechtensteinischen Flurnamen (BROGGI 1973), zu bisherigen<br />
Nachweisen von Wildschweinen in Gegenwart und Ver -<br />
gangenheit (BROGGI 1974), der Ausrottungsgeschichte des<br />
Grossraubwildes (BROGGI 1979), der Verlustbilanz der Feuchtgebiete<br />
(BROGGI 1984) sowie dem Landschaftswandel im<br />
Talraum (BROGGI 1988). Sie alle enthalten auch Aussagen zu<br />
Säugetiervorkommen in <strong>Liechtenstein</strong>.<br />
Nur mehr eine weitere Arbeit von Patrik WIEDEMEIER (1990)<br />
widmet sich den Kleinsäugern des Naturschutzgebietes Ruggeller<br />
Riet. Die übrigen Säugetiere werden in der Ruggeller<br />
Riet-Monografie in BROGGI (1990) beschrieben. Der Feldhase<br />
ist seinerseits Gegenstand einer grenzüberschreitenden Studie<br />
für das Alpenrheintal (HOLZGANG & PFISTER 2003).<br />
Schalenwildbewirtschaftung erfordert Forschungen<br />
Mit den wachsenden Wald-Wildproblemen wurde die wildkundliche<br />
Forschung in <strong>Liechtenstein</strong> intensiviert. Den Auftakt<br />
machte das veröffentlichte Gutachten zur integralen<br />
Schalenwild-Bewirtschaftung des Forschungsinstitutes für<br />
Wildtierkunde der Veterinärmedizinischen Universität in<br />
Wien (ONDERSCHENKA et al. 1989) und in populärer Fassung<br />
(REIMOSER 1990). Ihm folgten zehn weitere Veröffentlichungen<br />
im Bereich «Wildtiere und Jagd». Sie behandeln die<br />
Wald-Wild-Strategie, die Wildlebensräume, die Freizeitnut-<br />
zung, die Grösse der tragbaren Rotwildbestände, das Notfütterungskonzept,<br />
den Abschussplan. FASEL (1990) beschreibt<br />
zudem in einem populären Beitrag die Gams und<br />
die Wildtier-Lebensräume des Schalenwildes. Im UNO-Jahr<br />
der Biodiversität folgt ein Beitrag über die Tierartenvielfalt<br />
(FASEL 2010). Michael Fasel betreute auch die Pressemitteilungen<br />
des AWNL über erste Beobachtungen des eingewanderten<br />
Luchses sowie des Marderhundes.<br />
Intensive Fledermauserforschung<br />
Am intensivsten wurde bisher die Erforschung der liechtensteinischen<br />
Fledermaus-Fauna vorangetrieben. Patrik Wiedemeier<br />
erstellte 1984, mit neuen technischen Hilfsmitteln<br />
ausgestattet, eine Übersicht über die Fledermausarten des<br />
Landes (WIEDEMEIER 1984). Die Autoren René Güttinger, Hans<br />
Wietlisbach, René Gerber und Silvio Hoch betreuten die bedeutende<br />
Mausohrenkolonie in der Triesner Pfarrkirche<br />
während der Kirchenrenovation (GÜTTINGER et al. 1994). HOCH<br />
& GERBER (1999) bringen in einem Beitrag in der BZG-Alpenrhein-Monografie<br />
einen Überblick über die Fledermäuse<br />
am Rhein. BECK et al. (2006) und GÜTTINGER et al (2006a) berichten<br />
über die Nahrung des Grossen Mausohrs (Myotis<br />
myotis) und der Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)<br />
in <strong>Liechtenstein</strong>. Die Förderung potentieller Jagdhabitate<br />
für das Kleine Mausohr (Myothis blythii) wird in einem<br />
grenzüberschreitenden Konzept für das nördliche Alpen -<br />
rheintal im Rahmen des Interreg IIIB–Lebensraumvernetzung<br />
mit Abschlussbericht Mai 2006 vorgelegt GÜTTINGER et<br />
al (2006b). Ab 1993 berichtet Silvio Hoch alljährlich als<br />
Betreuer der Arbeitsgruppe für Fledermausschutz über ent -<br />
sprechende neue Erkenntnisse in den Berichten der Botanisch-Zoologischen<br />
Gesellschaft <strong>Liechtenstein</strong>-Sargans-Werdenberg.<br />
Abklärungen über Neueinwanderer<br />
Die säugetierkundlichen Arbeiten der neuesten Zeit widmen<br />
sich den Neueinwanderern. In einer Neozoen-Schwerpunktnummer<br />
der Berichte der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft<br />
und der naturkundlichen Reihe des Landes werden<br />
die Neueinwanderer Bisamratte, Waschbär und der zu erwartende<br />
Marderhund angesprochen (BROGGI 2006). Der<br />
zoologische Präparator Peter Niederklopfer hat ebenso zum<br />
Waschbären in <strong>Liechtenstein</strong> einen Beitrag geschrieben<br />
(NIEDERKLOPFER 2002). KRÄMER (2006) behandelt seinerseits die<br />
Ausbreitung der Bisamratte in der Nordostschweiz und zeigt<br />
auch den Verlauf der Ausbreitung am Alpenrhein.<br />
Auch im Kanton St.Gallen wird den Neozoen grössere Aufmerksamkeit<br />
mit einigen Beiträgen in der Naturwissenschaftlichen<br />
Gesellschaft gewidmet (HOFMANN 1993 für<br />
Waschbär und Marderhund, Bisam und Nutria). Auch die<br />
Wiedereinwanderer Schwarzwild (BAETTIG 1993) und Biber<br />
(RAHM 1993) werden behandelt.<br />
Mario F. Broggi<br />
17