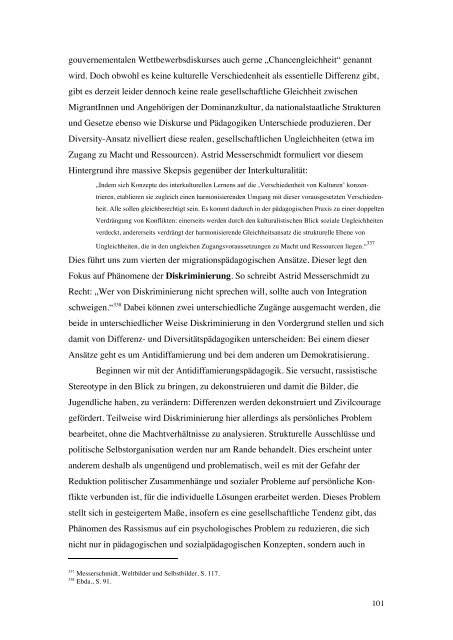Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gouvernementalen Wettbewerbsdiskurses auch gerne „Chancengleichheit“ genannt<br />
wird. Doch obwohl es keine kulturelle Verschiedenheit als essentielle Differenz gibt,<br />
gibt es <strong>der</strong>zeit lei<strong>der</strong> dennoch keine reale gesellschaftliche Gleichheit zwischen<br />
MigrantInnen und Angehörigen <strong>der</strong> Dominanzkultur, da nationalstaatliche Strukturen<br />
und Gesetze ebenso wie Diskurse und Pädagogiken Unterschiede produzieren. Der<br />
Diversity-Ansatz nivelliert diese realen, gesellschaftlichen Ungleichheiten (etwa im<br />
Zugang zu Macht und Ressourcen). Astrid Messerschmidt formuliert vor diesem<br />
Hintergrund ihre massive Skepsis gegenüber <strong>der</strong> Interkulturalität:<br />
„Indem sich Konzepte des interkulturellen <strong>Lernen</strong>s auf die ‚Verschiedenheit von Kulturen’ konzentrieren,<br />
etablieren sie zugleich einen harmonisierenden Umgang mit dieser vorausgesetzten Verschiedenheit.<br />
Alle sollen gleichberechtigt sein. Es kommt dadurch in <strong>der</strong> pädagogischen Praxis zu einer doppelten<br />
Verdrängung von Konflikten: einerseits werden durch den kulturalistischen Blick soziale Ungleichheiten<br />
verdeckt, an<strong>der</strong>erseits verdrängt <strong>der</strong> harmonisierende Gleichheitsansatz die strukturelle Ebene von<br />
Ungleichheiten, die in den ungleichen Zugangsvoraussetzungen zu Macht und Ressourcen liegen.“ 337<br />
Dies führt uns zum vierten <strong>der</strong> migrationspädagogischen Ansätze. Dieser legt den<br />
Fokus auf Phänomene <strong>der</strong> Diskriminierung. So schreibt Astrid Messerschmidt zu<br />
Recht: „Wer von Diskriminierung nicht sprechen will, sollte auch von Integration<br />
schweigen.“ 338 Dabei können zwei unterschiedliche Zugänge ausgemacht werden, die<br />
beide in unterschiedlicher Weise Diskriminierung in den Vor<strong>der</strong>grund stellen und sich<br />
damit von Differenz- und Diversitätspädagogiken unterscheiden: Bei einem dieser<br />
Ansätze geht es um Antidiffamierung und bei dem an<strong>der</strong>en um Demokratisierung.<br />
Beginnen wir mit <strong>der</strong> Antidiffamierungspädagogik. Sie versucht, rassistische<br />
Stereotype in den Blick zu bringen, zu dekonstruieren und damit die Bil<strong>der</strong>, die<br />
Jugendliche haben, zu verän<strong>der</strong>n: Differenzen werden dekonstruiert und Zivilcourage<br />
geför<strong>der</strong>t. Teilweise wird Diskriminierung hier allerdings als persönliches Problem<br />
bearbeitet, ohne die Machtverhältnisse zu analysieren. Strukturelle Ausschlüsse und<br />
politische Selbstorganisation werden nur am Rande behandelt. Dies erscheint unter<br />
an<strong>der</strong>em deshalb als ungenügend und problematisch, weil es mit <strong>der</strong> Gefahr <strong>der</strong><br />
Reduktion politischer Zusammenhänge und sozialer Probleme auf persönliche Konflikte<br />
verbunden ist, für die individuelle Lösungen erarbeitet werden. Dieses Problem<br />
stellt sich in gesteigertem Maße, insofern es eine gesellschaftliche Tendenz gibt, das<br />
Phänomen des Rassismus auf ein psychologisches Problem zu reduzieren, die sich<br />
nicht nur in pädagogischen und sozialpädagogischen Konzepten, son<strong>der</strong>n auch in<br />
337 Messerschmidt, Weltbil<strong>der</strong> und Selbstbil<strong>der</strong>, S. 117.<br />
338 Ebda., S. 91.<br />
101