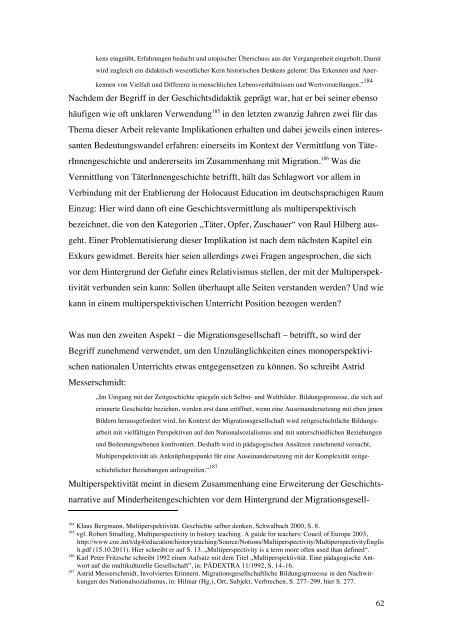Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
kens eingeübt, Erfahrungen bedacht und utopischer Überschuss aus <strong>der</strong> Vergangenheit eingeholt. Damit<br />
wird zugleich ein didaktisch wesentlicher Kern historischen Denkens gelernt: Das Erkennen und Anerkennen<br />
von Vielfalt und Differenz in menschlichen Lebensverhältnissen und Wertvorstellungen.” 184<br />
Nachdem <strong>der</strong> Begriff in <strong>der</strong> Geschichtsdidaktik geprägt war, hat er bei seiner ebenso<br />
häufigen wie oft unklaren Verwendung 185 in den letzten zwanzig Jahren zwei für das<br />
Thema dieser Arbeit relevante Implikationen erhalten und dabei jeweils einen interessanten<br />
Bedeutungswandel erfahren: einerseits im Kontext <strong>der</strong> Vermittlung von TäterInnengeschichte<br />
und an<strong>der</strong>erseits im Zusammenhang mit Migration. 186 Was die<br />
Vermittlung von TäterInnengeschichte betrifft, hält das Schlagwort vor allem in<br />
Verbindung mit <strong>der</strong> Etablierung <strong>der</strong> Holocaust Education im deutschsprachigen Raum<br />
Einzug: Hier wird dann oft eine <strong>Geschichtsvermittlung</strong> als multiperspektivisch<br />
bezeichnet, die von den Kategorien „Täter, Opfer, Zuschauer“ von Raul Hilberg ausgeht.<br />
Einer Problematisierung dieser Implikation ist nach dem nächsten Kapitel ein<br />
Exkurs gewidmet. Bereits hier seien allerdings zwei Fragen angesprochen, die sich<br />
vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Gefahr eines Relativismus stellen, <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Multiperspektivität<br />
verbunden sein kann: Sollen überhaupt alle Seiten verstanden werden? Und wie<br />
kann in einem multiperspektivischen Unterricht Position bezogen werden?<br />
Was nun den zweiten Aspekt – die Migrationsgesellschaft – betrifft, so wird <strong>der</strong><br />
Begriff zunehmend verwendet, um den Unzulänglichkeiten eines monoperspektivischen<br />
nationalen Unterrichts etwas entgegensetzen zu können. So schreibt Astrid<br />
Messerschmidt:<br />
„Im Umgang mit <strong>der</strong> Zeitgeschichte spiegeln sich Selbst- und Weltbil<strong>der</strong>. Bildungsprozesse, die sich auf<br />
erinnerte Geschichte beziehen, werden erst dann eröffnet, wenn eine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit eben jenen<br />
Bil<strong>der</strong>n herausgefor<strong>der</strong>t wird. Im Kontext <strong>der</strong> Migrationsgesellschaft wird zeitgeschichtliche Bildungsarbeit<br />
mit vielfältigen Perspektiven auf den Nationalsozialismus und mit unterschiedlichen Beziehungen<br />
und Bedeutungsebenen konfrontiert. Deshalb wird in pädagogischen Ansätzen zunehmend versucht,<br />
Multiperspektivität als Anknüpfungspunkt für eine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> Komplexität zeitgeschichtlicher<br />
Beziehungen aufzugreifen.“ 187<br />
Multiperspektivität meint in diesem Zusammenhang eine Erweiterung <strong>der</strong> Geschichtsnarrative<br />
auf Min<strong>der</strong>heitengeschichten vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Migrationsgesell-<br />
184 Klaus Bergmann, Multiperspektivität. Geschichte selber denken, Schwalbach 2000, S. 8.<br />
185 vgl. Robert Stradling, Multiperspectivity in history teaching. A guide for teachers: Coucil of Europe 2003,<br />
http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Notions/Multiperspectivity/MultiperspectivityEnglis<br />
h.pdf (15.10.2011). Hier schreibt er auf S. 13. „Multiperspectivity is a term more often used than defined“.<br />
186 Karl Peter Fritzsche schreibt 1992 einen Aufsatz mit dem Titel „Multiperspektivität. Eine pädagogische Antwort<br />
auf die multikulturelle Gesellschaft”, in: PÄDEXTRA 11/1992, S. 14–16.<br />
187 Astrid Messerschmidt, Involviertes Erinnern. Migrationsgesellschaftliche Bildungsprozesse in den Nachwirkungen<br />
des Nationalsozialismus, in: Hilmar (Hg.), Ort, Subjekt, Verbrechen, S. 277–299, hier S. 277.<br />
62