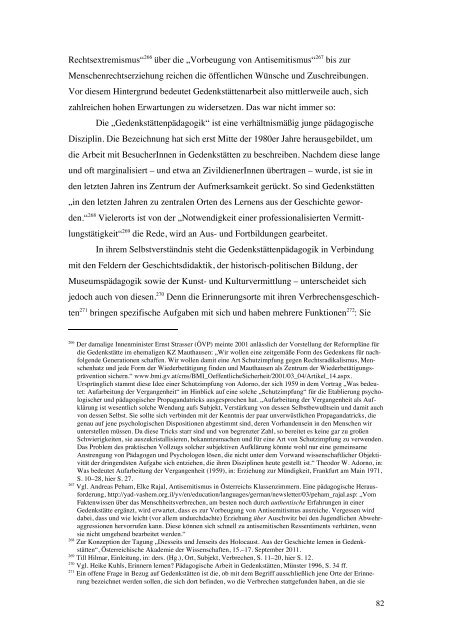Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rechtsextremismus“ 266 über die „Vorbeugung von Antisemitismus“ 267 bis zur<br />
Menschenrechtserziehung reichen die öffentlichen Wünsche und Zuschreibungen.<br />
Vor diesem Hintergrund bedeutet Gedenkstättenarbeit also mittlerweile auch, sich<br />
zahlreichen hohen Erwartungen zu wi<strong>der</strong>setzen. Das war nicht immer so:<br />
Die „Gedenkstättenpädagogik“ ist eine verhältnismäßig junge pädagogische<br />
Disziplin. Die Bezeichnung hat sich erst Mitte <strong>der</strong> 1980er Jahre herausgebildet, um<br />
die Arbeit mit BesucherInnen in Gedenkstätten zu beschreiben. Nachdem diese lange<br />
und oft marginalisiert – und etwa an ZivildienerInnen übertragen – wurde, ist sie in<br />
den letzten Jahren ins Zentrum <strong>der</strong> Aufmerksamkeit gerückt. So sind Gedenkstätten<br />
„in den letzten Jahren zu zentralen Orten des <strong>Lernen</strong>s aus <strong>der</strong> Geschichte geworden.“<br />
268 Vielerorts ist von <strong>der</strong> „Notwendigkeit einer professionalisierten Vermittlungstätigkeit“<br />
269 die Rede, wird an Aus- und Fortbildungen gearbeitet.<br />
In ihrem Selbstverständnis steht die Gedenkstättenpädagogik in Verbindung<br />
mit den Fel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Geschichtsdidaktik, <strong>der</strong> historisch-politischen Bildung, <strong>der</strong><br />
Museumspädagogik sowie <strong>der</strong> Kunst- und Kulturvermittlung – unterscheidet sich<br />
jedoch auch von diesen. 270 Denn die Erinnerungsorte mit ihren Verbrechensgeschichten<br />
271 bringen spezifische Aufgaben mit sich und haben mehrere Funktionen 272 : Sie<br />
266 Der damalige Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) meinte 2001 anlässlich <strong>der</strong> Vorstellung <strong>der</strong> Reformpläne für<br />
die Gedenkstätte im ehemaligen KZ Mauthausen: „Wir wollen eine zeitgemäße Form des Gedenkens für nachfolgende<br />
Generationen schaffen. Wir wollen damit eine Art Schutzimpfung gegen Rechtsradikalismus, Menschenhatz<br />
und jede Form <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>betätigung finden und Mauthausen als Zentrum <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>betätigungsprävention<br />
sichern.“ www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2001/03_04/Artikel_14.aspx.<br />
Ursprünglich stammt diese Idee einer Schutzimpfung von Adorno, <strong>der</strong> sich 1959 in dem Vortrag „Was bedeutet:<br />
Aufarbeitung <strong>der</strong> Vergangenheit“ im Hinblick auf eine solche „Schutzimpfung“ für die Etablierung psychologischer<br />
und pädagogischer Propagandatricks ausgesprochen hat. „Aufarbeitung <strong>der</strong> Vergangenheit als Aufklärung<br />
ist wesentlich solche Wendung aufs Subjekt, Verstärkung von dessen Selbstbewußtsein und damit auch<br />
von dessen Selbst. Sie sollte sich verbinden mit <strong>der</strong> Kenntnis <strong>der</strong> paar unverwüstlichen Propagandatricks, die<br />
genau auf jene psychologischen Dispositionen abgestimmt sind, <strong>der</strong>en Vorhandensein in den Menschen wir<br />
unterstellen müssen. Da diese Tricks starr sind und von begrenzter Zahl, so bereitet es keine gar zu großen<br />
Schwierigkeiten, sie auszukristallisieren, bekanntzumachen und für eine Art von Schutzimpfung zu verwenden.<br />
Das Problem des praktischen Vollzugs solcher subjektiven Aufklärung könnte wohl nur eine gemeinsame<br />
Anstrengung von Pädagogen und Psychologen lösen, die nicht unter dem Vorwand wissenschaftlicher Objektivität<br />
<strong>der</strong> dringendsten Aufgabe sich entziehen, die ihren Disziplinen heute gestellt ist.“ Theodor W. Adorno, in:<br />
Was bedeutet Aufarbeitung <strong>der</strong> Vergangenheit (1959), in: Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt am Main 1971,<br />
S. 10–28, hier S. 27.<br />
267 Vgl. Andreas Peham, Elke Rajal, Antisemitismus in Österreichs Klassenzimmern. Eine pädagogische Herausfor<strong>der</strong>ung,<br />
http://yad-vashem.org.il/yv/en/education/languages/german/newsletter/03/peham_rajal.asp: „Vom<br />
Faktenwissen über das Menschheitsverbrechen, am besten noch durch authentische Erfahrungen in einer<br />
Gedenkstätte ergänzt, wird erwartet, dass es zur Vorbeugung von Antisemitismus ausreiche. Vergessen wird<br />
dabei, dass und wie leicht (vor allem undurchdachte) Erziehung über Auschwitz bei den Jugendlichen Abwehraggressionen<br />
hervorrufen kann. Diese können sich schnell zu antisemitischen Ressentiments verhärten, wenn<br />
sie nicht umgehend bearbeitet werden.“<br />
268 Zur Konzeption <strong>der</strong> Tagung „Diesseits und Jenseits des Holocaust. Aus <strong>der</strong> Geschichte lernen in Gedenkstätten“,<br />
Österreichische Akademie <strong>der</strong> Wissenschaften, 15.–17. September 2011.<br />
269 Till Hilmar, Einleitung, in: <strong>der</strong>s. (Hg.), Ort, Subjekt, Verbrechen, S. 11–20, hier S. 12.<br />
270 Vgl. Heike Kuhls, Erinnern lernen? Pädagogische Arbeit in Gedenkstätten, Münster 1996, S. 34 ff.<br />
271 Ein offene Frage in Bezug auf Gedenkstätten ist die, ob mit dem Begriff ausschließlich jene Orte <strong>der</strong> Erinnerung<br />
bezeichnet werden sollen, die sich dort befinden, wo die Verbrechen stattgefunden haben, an die sie<br />
82