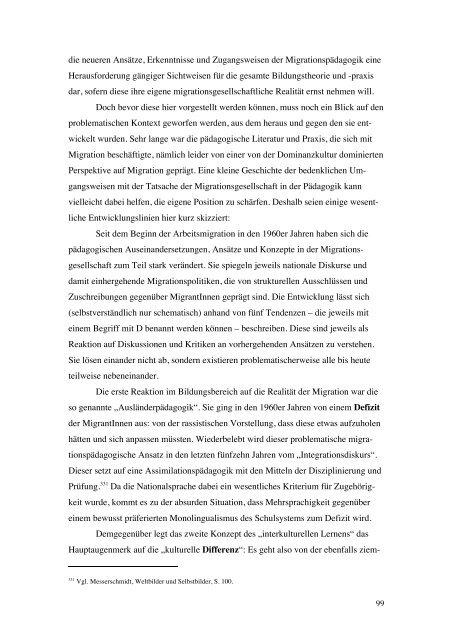Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die neueren Ansätze, Erkenntnisse und Zugangsweisen <strong>der</strong> Migrationspädagogik eine<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung gängiger Sichtweisen für die gesamte Bildungstheorie und -praxis<br />
dar, sofern diese ihre eigene migrationsgesellschaftliche Realität ernst nehmen will.<br />
Doch bevor diese hier vorgestellt werden können, muss noch ein Blick auf den<br />
problematischen Kontext geworfen werden, aus dem heraus und gegen den sie entwickelt<br />
wurden. Sehr lange war die pädagogische Literatur und Praxis, die sich mit<br />
Migration beschäftigte, nämlich lei<strong>der</strong> von einer von <strong>der</strong> Dominanzkultur dominierten<br />
Perspektive auf Migration geprägt. Eine kleine Geschichte <strong>der</strong> bedenklichen Umgangsweisen<br />
mit <strong>der</strong> Tatsache <strong>der</strong> Migrationsgesellschaft in <strong>der</strong> Pädagogik kann<br />
vielleicht dabei helfen, die eigene Position zu schärfen. Deshalb seien einige wesentliche<br />
Entwicklungslinien hier kurz skizziert:<br />
Seit dem Beginn <strong>der</strong> Arbeitsmigration in den 1960er Jahren haben sich die<br />
pädagogischen Auseinan<strong>der</strong>setzungen, Ansätze und Konzepte in <strong>der</strong> Migrationsgesellschaft<br />
zum Teil stark verän<strong>der</strong>t. Sie spiegeln jeweils nationale Diskurse und<br />
damit einhergehende Migrationspolitiken, die von strukturellen Ausschlüssen und<br />
Zuschreibungen gegenüber MigrantInnen geprägt sind. Die Entwicklung lässt sich<br />
(selbstverständlich nur schematisch) anhand von fünf Tendenzen – die jeweils mit<br />
einem Begriff mit D benannt werden können – beschreiben. Diese sind jeweils als<br />
Reaktion auf Diskussionen und Kritiken an vorhergehenden Ansätzen zu verstehen.<br />
Sie lösen einan<strong>der</strong> nicht ab, son<strong>der</strong>n existieren problematischerweise alle bis heute<br />
teilweise nebeneinan<strong>der</strong>.<br />
Die erste Reaktion im Bildungsbereich auf die Realität <strong>der</strong> Migration war die<br />
so genannte „Auslän<strong>der</strong>pädagogik“. Sie ging in den 1960er Jahren von einem Defizit<br />
<strong>der</strong> MigrantInnen aus: von <strong>der</strong> rassistischen Vorstellung, dass diese etwas aufzuholen<br />
hätten und sich anpassen müssten. Wie<strong>der</strong>belebt wird dieser problematische migrationspädagogische<br />
Ansatz in den letzten fünfzehn Jahren vom „Integrationsdiskurs“.<br />
Dieser setzt auf eine Assimilationspädagogik mit den Mitteln <strong>der</strong> Disziplinierung und<br />
Prüfung. 331 Da die Nationalsprache dabei ein wesentliches Kriterium für Zugehörigkeit<br />
wurde, kommt es zu <strong>der</strong> absurden Situation, dass Mehrsprachigkeit gegenüber<br />
einem bewusst präferierten Monolingualismus des Schulsystems zum Defizit wird.<br />
Demgegenüber legt das zweite Konzept des „interkulturellen <strong>Lernen</strong>s“ das<br />
Hauptaugenmerk auf die „kulturelle Differenz“: Es geht also von <strong>der</strong> ebenfalls ziem-<br />
331 Vgl. Messerschmidt, Weltbil<strong>der</strong> und Selbstbil<strong>der</strong>, S. 100.<br />
99