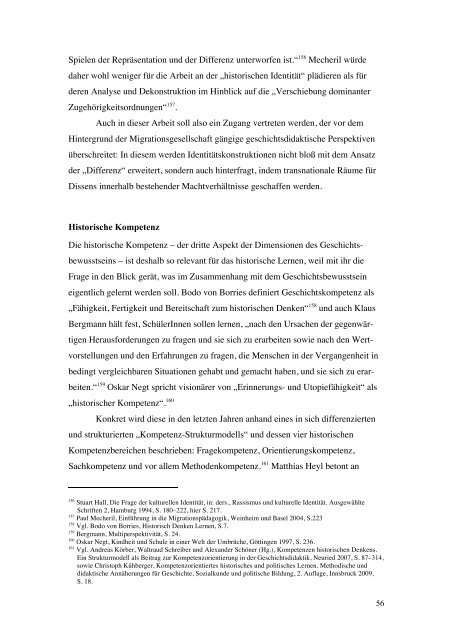Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Spielen <strong>der</strong> Repräsentation und <strong>der</strong> Differenz unterworfen ist.“ 156 Mecheril würde<br />
daher wohl weniger für die Arbeit an <strong>der</strong> „historischen Identität“ plädieren als für<br />
<strong>der</strong>en Analyse und Dekonstruktion im Hinblick auf die „Verschiebung dominanter<br />
Zugehörigkeitsordnungen“ 157 .<br />
Auch in dieser Arbeit soll also ein Zugang vertreten werden, <strong>der</strong> vor dem<br />
Hintergrund <strong>der</strong> Migrationsgesellschaft gängige geschichtsdidaktische Perspektiven<br />
überschreitet: In diesem werden Identitätskonstruktionen nicht bloß mit dem Ansatz<br />
<strong>der</strong> „Differenz“ erweitert, son<strong>der</strong>n auch hinterfragt, indem transnationale Räume für<br />
Dissens innerhalb bestehen<strong>der</strong> Machtverhältnisse geschaffen werden.<br />
Historische Kompetenz<br />
Die historische Kompetenz – <strong>der</strong> dritte Aspekt <strong>der</strong> Dimensionen des Geschichtsbewusstseins<br />
– ist deshalb so relevant für das historische <strong>Lernen</strong>, weil mit ihr die<br />
Frage in den Blick gerät, was im Zusammenhang mit dem Geschichtsbewusstsein<br />
eigentlich gelernt werden soll. Bodo von Borries definiert Geschichtskompetenz als<br />
„Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft zum historischen Denken“ 158 und auch Klaus<br />
Bergmann hält fest, SchülerInnen sollen lernen, „nach den Ursachen <strong>der</strong> gegenwärtigen<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen zu fragen und sie sich zu erarbeiten sowie nach den Wertvorstellungen<br />
und den Erfahrungen zu fragen, die Menschen in <strong>der</strong> Vergangenheit in<br />
bedingt vergleichbaren Situationen gehabt und gemacht haben, und sie sich zu erarbeiten.“<br />
159 Oskar Negt spricht visionärer von „Erinnerungs- und Utopiefähigkeit“ als<br />
„historischer Kompetenz“. 160<br />
Konkret wird diese in den letzten Jahren anhand eines in sich differenzierten<br />
und strukturierten „Kompetenz-Strukturmodells“ und dessen vier historischen<br />
Kompetenzbereichen beschrieben: Fragekompetenz, Orientierungskompetenz,<br />
Sachkompetenz und vor allem Methodenkompetenz. 161 Matthias Heyl betont an<br />
156 Stuart Hall, Die Frage <strong>der</strong> kulturellen Identität, in: <strong>der</strong>s., Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte<br />
Schriften 2, Hamburg 1994, S. 180–222, hier S. 217.<br />
157 Paul Mecheril, Einführung in die Migrationspädagogik, Weinheim und Basel 2004, S.223<br />
158 Vgl. Bodo von Borries, Historisch Denken <strong>Lernen</strong>, S.7.<br />
159 Bergmann, Multiperspektivität, S. 24.<br />
160 Oskar Negt, Kindheit und Schule in einer Welt <strong>der</strong> Umbrüche, Göttingen 1997, S. 236.<br />
161 Vgl. Andreas Körber, Waltraud Schreiber und Alexan<strong>der</strong> Schöner (Hg.), Kompetenzen historischen Denkens.<br />
Ein Strukturmodell als Beitrag zur Kompetenzorientierung in <strong>der</strong> Geschichtsdidaktik, Neuried 2007, S. 87–314,<br />
sowie Christoph Kühberger, Kompetenzorientiertes historisches und politisches <strong>Lernen</strong>. Methodische und<br />
didaktische Annäherungen für Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung, 2. Auflage, Innsbruck 2009,<br />
S. 18.<br />
56