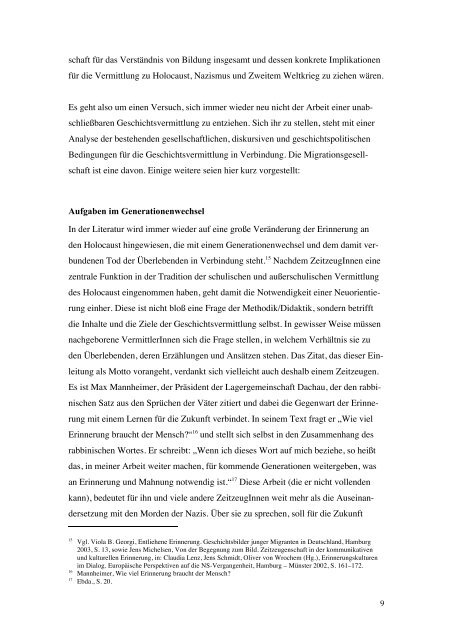Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schaft für das Verständnis von Bildung insgesamt und dessen konkrete Implikationen<br />
für die Vermittlung zu Holocaust, Nazismus und Zweitem Weltkrieg zu ziehen wären.<br />
Es geht also um einen Versuch, sich immer wie<strong>der</strong> neu nicht <strong>der</strong> Arbeit einer unabschließbaren<br />
<strong>Geschichtsvermittlung</strong> zu entziehen. Sich ihr zu stellen, steht mit einer<br />
Analyse <strong>der</strong> bestehenden gesellschaftlichen, diskursiven und geschichtspolitischen<br />
Bedingungen für die <strong>Geschichtsvermittlung</strong> in Verbindung. Die Migrationsgesellschaft<br />
ist eine davon. Einige weitere seien hier kurz vorgestellt:<br />
Aufgaben im Generationenwechsel<br />
In <strong>der</strong> Literatur wird immer wie<strong>der</strong> auf eine große Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erinnerung an<br />
den Holocaust hingewiesen, die mit einem Generationenwechsel und dem damit verbundenen<br />
Tod <strong>der</strong> Überlebenden in Verbindung steht. 15 Nachdem ZeitzeugInnen eine<br />
zentrale Funktion in <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> schulischen und außerschulischen Vermittlung<br />
des Holocaust eingenommen haben, geht damit die Notwendigkeit einer Neuorientierung<br />
einher. Diese ist nicht bloß eine Frage <strong>der</strong> Methodik/Didaktik, son<strong>der</strong>n betrifft<br />
die Inhalte und die Ziele <strong>der</strong> <strong>Geschichtsvermittlung</strong> selbst. In gewisser Weise müssen<br />
nachgeborene VermittlerInnen sich die Frage stellen, in welchem Verhältnis sie zu<br />
den Überlebenden, <strong>der</strong>en Erzählungen und Ansätzen stehen. Das Zitat, das dieser Einleitung<br />
als Motto vorangeht, verdankt sich vielleicht auch deshalb einem Zeitzeugen.<br />
Es ist Max Mannheimer, <strong>der</strong> Präsident <strong>der</strong> Lagergemeinschaft Dachau, <strong>der</strong> den rabbinischen<br />
Satz aus den Sprüchen <strong>der</strong> Väter zitiert und dabei die Gegenwart <strong>der</strong> Erinnerung<br />
mit einem <strong>Lernen</strong> für die Zukunft verbindet. In seinem Text fragt er „Wie viel<br />
Erinnerung braucht <strong>der</strong> Mensch?“ 16 und stellt sich selbst in den Zusammenhang des<br />
rabbinischen Wortes. Er schreibt: „Wenn ich dieses Wort auf mich beziehe, so heißt<br />
das, in meiner Arbeit weiter machen, für kommende Generationen weitergeben, was<br />
an Erinnerung und Mahnung notwendig ist.“ 17 Diese Arbeit (die er nicht vollenden<br />
kann), bedeutet für ihn und viele an<strong>der</strong>e ZeitzeugInnen weit mehr als die Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit den Morden <strong>der</strong> Nazis. Über sie zu sprechen, soll für die Zukunft<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Vgl. Viola B. Georgi, Entliehene Erinnerung. Geschichtsbil<strong>der</strong> junger Migranten in Deutschland, Hamburg<br />
2003, S. 13, sowie Jens Michelsen, Von <strong>der</strong> Begegnung zum Bild. Zeitzeugenschaft in <strong>der</strong> kommunikativen<br />
und kulturellen Erinnerung, in: Claudia Lenz, Jens Schmidt, Oliver von Wrochem (Hg.), Erinnerungskulturen<br />
im Dialog. Europäische Perspektiven auf die NS-Vergangenheit, Hamburg – Münster 2002, S. 161–172.<br />
Mannheimer, Wie viel Erinnerung braucht <strong>der</strong> Mensch?<br />
Ebda., S. 20.<br />
9