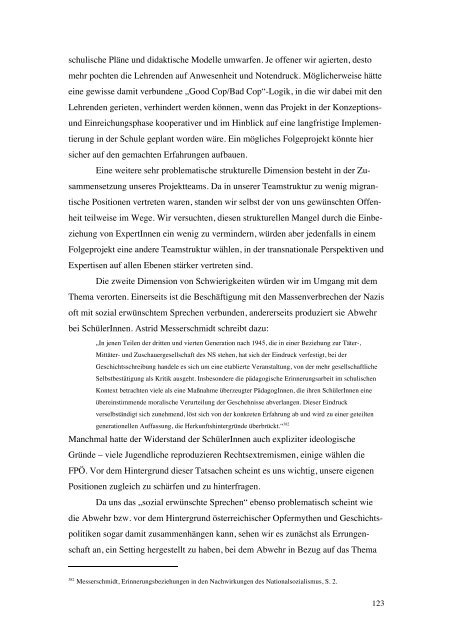Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schulische Pläne und didaktische Modelle umwarfen. Je offener wir agierten, desto<br />
mehr pochten die Lehrenden auf Anwesenheit und Notendruck. Möglicherweise hätte<br />
eine gewisse damit verbundene „Good Cop/Bad Cop“-Logik, in die wir dabei mit den<br />
Lehrenden gerieten, verhin<strong>der</strong>t werden können, wenn das Projekt in <strong>der</strong> Konzeptionsund<br />
Einreichungsphase kooperativer und im Hinblick auf eine langfristige Implementierung<br />
in <strong>der</strong> Schule geplant worden wäre. Ein mögliches Folgeprojekt könnte hier<br />
sicher auf den gemachten Erfahrungen aufbauen.<br />
Eine weitere sehr problematische strukturelle Dimension besteht in <strong>der</strong> Zusammensetzung<br />
unseres Projektteams. Da in unserer Teamstruktur zu wenig migrantische<br />
Positionen vertreten waren, standen wir selbst <strong>der</strong> von uns gewünschten Offenheit<br />
teilweise im Wege. Wir versuchten, diesen strukturellen Mangel durch die Einbeziehung<br />
von ExpertInnen ein wenig zu vermin<strong>der</strong>n, würden aber jedenfalls in einem<br />
Folgeprojekt eine an<strong>der</strong>e Teamstruktur wählen, in <strong>der</strong> transnationale Perspektiven und<br />
Expertisen auf allen Ebenen stärker vertreten sind.<br />
Die zweite Dimension von Schwierigkeiten würden wir im Umgang mit dem<br />
Thema verorten. Einerseits ist die Beschäftigung mit den Massenverbrechen <strong>der</strong> Nazis<br />
oft mit sozial erwünschtem Sprechen verbunden, an<strong>der</strong>erseits produziert sie Abwehr<br />
bei SchülerInnen. Astrid Messerschmidt schreibt dazu:<br />
„In jenen Teilen <strong>der</strong> dritten und vierten Generation nach 1945, die in einer Beziehung zur Täter-,<br />
Mittäter- und Zuschauergesellschaft des NS stehen, hat sich <strong>der</strong> Eindruck verfestigt, bei <strong>der</strong><br />
Geschichtsschreibung handele es sich um eine etablierte Veranstaltung, von <strong>der</strong> mehr gesellschaftliche<br />
Selbstbestätigung als Kritik ausgeht. Insbeson<strong>der</strong>e die pädagogische Erinnerungsarbeit im schulischen<br />
Kontext betrachten viele als eine Maßnahme überzeugter PädagogInnen, die ihren SchülerInnen eine<br />
übereinstimmende moralische Verurteilung <strong>der</strong> Geschehnisse abverlangen. Dieser Eindruck<br />
verselbständigt sich zunehmend, löst sich von <strong>der</strong> konkreten Erfahrung ab und wird zu einer geteilten<br />
generationellen Auffassung, die Herkunftshintergründe überbrückt.“ 382<br />
Manchmal hatte <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>stand <strong>der</strong> SchülerInnen auch expliziter ideologische<br />
Gründe – viele Jugendliche reproduzieren Rechtsextremismen, einige wählen die<br />
FPÖ. Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen scheint es uns wichtig, unsere eigenen<br />
Positionen zugleich zu schärfen und zu hinterfragen.<br />
Da uns das „sozial erwünschte Sprechen“ ebenso problematisch scheint wie<br />
die Abwehr bzw. vor dem Hintergrund österreichischer Opfermythen und Geschichtspolitiken<br />
sogar damit zusammenhängen kann, sehen wir es zunächst als Errungenschaft<br />
an, ein Setting hergestellt zu haben, bei dem Abwehr in Bezug auf das Thema<br />
382 Messerschmidt, Erinnerungsbeziehungen in den Nachwirkungen des Nationalsozialismus, S. 2.<br />
123