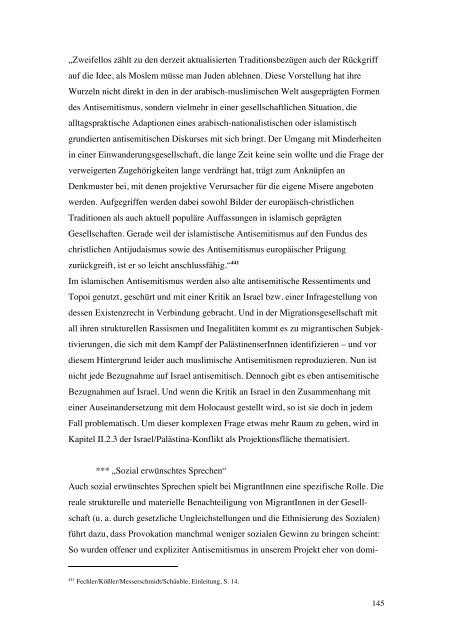Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Zweifellos zählt zu den <strong>der</strong>zeit aktualisierten Traditionsbezügen auch <strong>der</strong> Rückgriff<br />
auf die Idee, als Moslem müsse man Juden ablehnen. Diese Vorstellung hat ihre<br />
Wurzeln nicht direkt in den in <strong>der</strong> arabisch-muslimischen Welt ausgeprägten Formen<br />
des Antisemitismus, son<strong>der</strong>n vielmehr in einer gesellschaftlichen Situation, die<br />
alltagspraktische Adaptionen eines arabisch-nationalistischen o<strong>der</strong> islamistisch<br />
grundierten antisemitischen Diskurses mit sich bringt. Der Umgang mit Min<strong>der</strong>heiten<br />
in einer Einwan<strong>der</strong>ungsgesellschaft, die lange Zeit keine sein wollte und die Frage <strong>der</strong><br />
verweigerten Zugehörigkeiten lange verdrängt hat, trägt zum Anknüpfen an<br />
Denkmuster bei, mit denen projektive Verursacher für die eigene Misere angeboten<br />
werden. Aufgegriffen werden dabei sowohl Bil<strong>der</strong> <strong>der</strong> europäisch-christlichen<br />
Traditionen als auch aktuell populäre Auffassungen in islamisch geprägten<br />
Gesellschaften. Gerade weil <strong>der</strong> islamistische Antisemitismus auf den Fundus des<br />
christlichen Antijudaismus sowie des Antisemitismus europäischer Prägung<br />
zurückgreift, ist er so leicht anschlussfähig.“ 441<br />
Im islamischen Antisemitismus werden also alte antisemitische Ressentiments und<br />
Topoi genutzt, geschürt und mit einer Kritik an Israel bzw. einer Infragestellung von<br />
dessen Existenzrecht in Verbindung gebracht. Und in <strong>der</strong> Migrationsgesellschaft mit<br />
all ihren strukturellen Rassismen und Inegalitäten kommt es zu migrantischen Subjektivierungen,<br />
die sich mit dem Kampf <strong>der</strong> PalästinenserInnen identifizieren – und vor<br />
diesem Hintergrund lei<strong>der</strong> auch muslimische Antisemitismen reproduzieren. Nun ist<br />
nicht jede Bezugnahme auf Israel antisemitisch. Dennoch gibt es eben antisemitische<br />
Bezugnahmen auf Israel. Und wenn die Kritik an Israel in den Zusammenhang mit<br />
einer Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem Holocaust gestellt wird, so ist sie doch in jedem<br />
Fall problematisch. Um dieser komplexen Frage etwas mehr Raum zu geben, wird in<br />
Kapitel II.2.3 <strong>der</strong> Israel/Palästina-Konflikt als Projektionsfläche thematisiert.<br />
*** „Sozial erwünschtes Sprechen“<br />
Auch sozial erwünschtes Sprechen spielt bei MigrantInnen eine spezifische Rolle. Die<br />
reale strukturelle und materielle Benachteiligung von MigrantInnen in <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
(u. a. durch gesetzliche Ungleichstellungen und die Ethnisierung des Sozialen)<br />
führt dazu, dass Provokation manchmal weniger sozialen Gewinn zu bringen scheint:<br />
So wurden offener und expliziter Antisemitismus in unserem Projekt eher von domi-<br />
441 Fechler/Kößler/Messerschmidt/Schäuble, Einleitung, S. 14.<br />
145