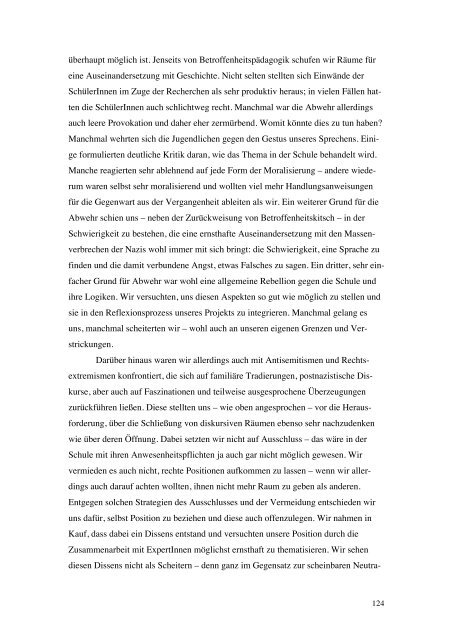Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
überhaupt möglich ist. Jenseits von Betroffenheitspädagogik schufen wir Räume für<br />
eine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Geschichte. Nicht selten stellten sich Einwände <strong>der</strong><br />
SchülerInnen im Zuge <strong>der</strong> Recherchen als sehr produktiv heraus; in vielen Fällen hatten<br />
die SchülerInnen auch schlichtweg recht. Manchmal war die Abwehr allerdings<br />
auch leere Provokation und daher eher zermürbend. Womit könnte dies zu tun haben?<br />
Manchmal wehrten sich die Jugendlichen gegen den Gestus unseres Sprechens. Einige<br />
formulierten deutliche Kritik daran, wie das Thema in <strong>der</strong> Schule behandelt wird.<br />
Manche reagierten sehr ablehnend auf jede Form <strong>der</strong> Moralisierung – an<strong>der</strong>e wie<strong>der</strong>um<br />
waren selbst sehr moralisierend und wollten viel mehr Handlungsanweisungen<br />
für die Gegenwart aus <strong>der</strong> Vergangenheit ableiten als wir. Ein weiterer Grund für die<br />
Abwehr schien uns – neben <strong>der</strong> Zurückweisung von Betroffenheitskitsch – in <strong>der</strong><br />
Schwierigkeit zu bestehen, die eine ernsthafte Auseinan<strong>der</strong>setzung mit den Massenverbrechen<br />
<strong>der</strong> Nazis wohl immer mit sich bringt: die Schwierigkeit, eine Sprache zu<br />
finden und die damit verbundene Angst, etwas Falsches zu sagen. Ein dritter, sehr einfacher<br />
Grund für Abwehr war wohl eine allgemeine Rebellion gegen die Schule und<br />
ihre Logiken. Wir versuchten, uns diesen Aspekten so gut wie möglich zu stellen und<br />
sie in den Reflexionsprozess unseres Projekts zu integrieren. Manchmal gelang es<br />
uns, manchmal scheiterten wir – wohl auch an unseren eigenen Grenzen und Verstrickungen.<br />
Darüber hinaus waren wir allerdings auch mit Antisemitismen und Rechtsextremismen<br />
konfrontiert, die sich auf familiäre Tradierungen, postnazistische Diskurse,<br />
aber auch auf Faszinationen und teilweise ausgesprochene Überzeugungen<br />
zurückführen ließen. Diese stellten uns – wie oben angesprochen – vor die Herausfor<strong>der</strong>ung,<br />
über die Schließung von diskursiven Räumen ebenso sehr nachzudenken<br />
wie über <strong>der</strong>en Öffnung. Dabei setzten wir nicht auf Ausschluss – das wäre in <strong>der</strong><br />
Schule mit ihren Anwesenheitspflichten ja auch gar nicht möglich gewesen. Wir<br />
vermieden es auch nicht, rechte Positionen aufkommen zu lassen – wenn wir allerdings<br />
auch darauf achten wollten, ihnen nicht mehr Raum zu geben als an<strong>der</strong>en.<br />
Entgegen solchen Strategien des Ausschlusses und <strong>der</strong> Vermeidung entschieden wir<br />
uns dafür, selbst Position zu beziehen und diese auch offenzulegen. Wir nahmen in<br />
Kauf, dass dabei ein Dissens entstand und versuchten unsere Position durch die<br />
Zusammenarbeit mit ExpertInnen möglichst ernsthaft zu thematisieren. Wir sehen<br />
diesen Dissens nicht als Scheitern – denn ganz im Gegensatz zur scheinbaren Neutra-<br />
124