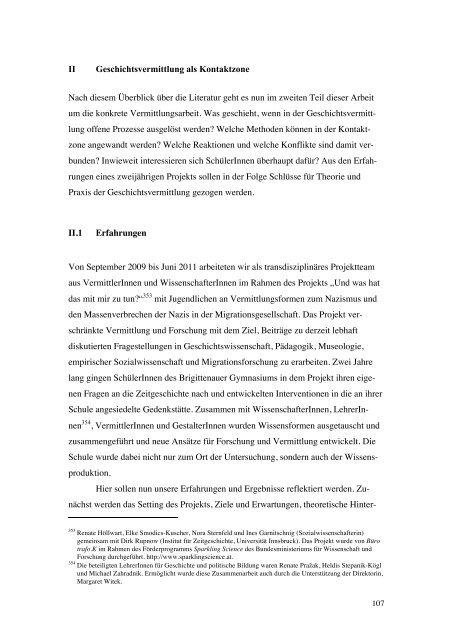Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
II<br />
<strong>Geschichtsvermittlung</strong> als Kontaktzone<br />
Nach diesem Überblick über die Literatur geht es nun im zweiten Teil dieser Arbeit<br />
um die konkrete Vermittlungsarbeit. Was geschieht, wenn in <strong>der</strong> <strong>Geschichtsvermittlung</strong><br />
offene Prozesse ausgelöst werden? Welche Methoden können in <strong>der</strong> Kontaktzone<br />
angewandt werden? Welche Reaktionen und welche Konflikte sind damit verbunden?<br />
Inwieweit interessieren sich SchülerInnen überhaupt dafür? Aus den Erfahrungen<br />
eines zweijährigen Projekts sollen in <strong>der</strong> Folge Schlüsse für Theorie und<br />
Praxis <strong>der</strong> <strong>Geschichtsvermittlung</strong> gezogen werden.<br />
II.1<br />
Erfahrungen<br />
Von September 2009 bis Juni 2011 arbeiteten wir als transdisziplinäres Projektteam<br />
aus VermittlerInnen und WissenschafterInnen im Rahmen des Projekts „Und was hat<br />
das mit mir zu tun?“ 353 mit Jugendlichen an Vermittlungsformen zum Nazismus und<br />
den Massenverbrechen <strong>der</strong> Nazis in <strong>der</strong> Migrationsgesellschaft. Das Projekt verschränkte<br />
Vermittlung und Forschung mit dem Ziel, Beiträge zu <strong>der</strong>zeit lebhaft<br />
diskutierten Fragestellungen in Geschichtswissenschaft, Pädagogik, Museologie,<br />
empirischer Sozialwissenschaft und Migrationsforschung zu erarbeiten. Zwei Jahre<br />
lang gingen SchülerInnen des Brigittenauer Gymnasiums in dem Projekt ihren eigenen<br />
Fragen an die Zeitgeschichte nach und entwickelten Interventionen in die an ihrer<br />
Schule angesiedelte Gedenkstätte. Zusammen mit WissenschafterInnen, LehrerInnen<br />
354 , VermittlerInnen und GestalterInnen wurden Wissensformen ausgetauscht und<br />
zusammengeführt und neue Ansätze für Forschung und Vermittlung entwickelt. Die<br />
Schule wurde dabei nicht nur zum Ort <strong>der</strong> Untersuchung, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Wissensproduktion.<br />
Hier sollen nun unsere Erfahrungen und Ergebnisse reflektiert werden. Zunächst<br />
werden das Setting des Projekts, Ziele und Erwartungen, theoretische Hinter-<br />
353 Renate Höllwart, Elke Smodics-Kuscher, Nora Sternfeld und Ines Garnitschnig (Sozialwissenschafterin)<br />
gemeinsam mit Dirk Rupnow (Institut für Zeitgeschichte, Universität Innsbruck). Das Projekt wurde von Büro<br />
trafo.K im Rahmen des För<strong>der</strong>programms Sparkling Science des Bundesministeriums für Wissenschaft und<br />
Forschung durchgeführt. http://www.sparklingscience.at.<br />
354 Die beteiligten LehrerInnen für Geschichte und politische Bildung waren Renate Pražak, Heldis Stepanik-Kögl<br />
und Michael Zahradnik. Ermöglicht wurde diese Zusammenarbeit auch durch die Unterstützung <strong>der</strong> Direktorin,<br />
Margaret Witek.<br />
107