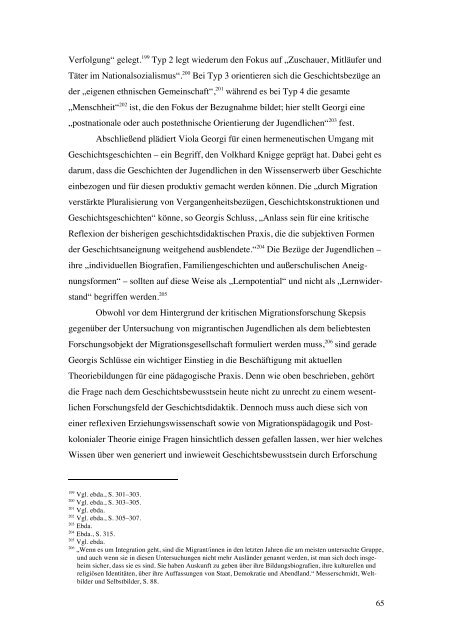Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verfolgung“ gelegt. 199 Typ 2 legt wie<strong>der</strong>um den Fokus auf „Zuschauer, Mitläufer und<br />
Täter im Nationalsozialismus“. 200 Bei Typ 3 orientieren sich die Geschichtsbezüge an<br />
<strong>der</strong> „eigenen ethnischen Gemeinschaft“, 201 während es bei Typ 4 die gesamte<br />
„Menschheit“ 202 ist, die den Fokus <strong>der</strong> Bezugnahme bildet; hier stellt Georgi eine<br />
„postnationale o<strong>der</strong> auch postethnische Orientierung <strong>der</strong> Jugendlichen“ 203 fest.<br />
Abschließend plädiert Viola Georgi für einen hermeneutischen Umgang mit<br />
Geschichtsgeschichten – ein Begriff, den Volkhard Knigge geprägt hat. Dabei geht es<br />
darum, dass die Geschichten <strong>der</strong> Jugendlichen in den Wissenserwerb über Geschichte<br />
einbezogen und für diesen produktiv gemacht werden können. Die „durch Migration<br />
verstärkte Pluralisierung von Vergangenheitsbezügen, Geschichtskonstruktionen und<br />
Geschichtsgeschichten“ könne, so Georgis Schluss, „Anlass sein für eine kritische<br />
Reflexion <strong>der</strong> bisherigen geschichtsdidaktischen Praxis, die die subjektiven Formen<br />
<strong>der</strong> Geschichtsaneignung weitgehend ausblendete.“ 204 Die Bezüge <strong>der</strong> Jugendlichen –<br />
ihre „individuellen Biografien, Familiengeschichten und außerschulischen Aneignungsformen“<br />
– sollten auf diese Weise als „Lernpotential“ und nicht als „Lernwi<strong>der</strong>stand“<br />
begriffen werden. 205<br />
Obwohl vor dem Hintergrund <strong>der</strong> kritischen Migrationsforschung Skepsis<br />
gegenüber <strong>der</strong> Untersuchung von migrantischen Jugendlichen als dem beliebtesten<br />
Forschungsobjekt <strong>der</strong> Migrationsgesellschaft formuliert werden muss, 206 sind gerade<br />
Georgis Schlüsse ein wichtiger Einstieg in die Beschäftigung mit aktuellen<br />
Theoriebildungen für eine pädagogische Praxis. Denn wie oben beschrieben, gehört<br />
die Frage nach dem Geschichtsbewusstsein heute nicht zu unrecht zu einem wesentlichen<br />
Forschungsfeld <strong>der</strong> Geschichtsdidaktik. Dennoch muss auch diese sich von<br />
einer reflexiven Erziehungswissenschaft sowie von Migrationspädagogik und Postkolonialer<br />
Theorie einige Fragen hinsichtlich dessen gefallen lassen, wer hier welches<br />
Wissen über wen generiert und inwieweit Geschichtsbewusstsein durch Erforschung<br />
199 Vgl. ebda., S. 301–303.<br />
200 Vgl. ebda., S. 303–305.<br />
201 Vgl. ebda.<br />
202 Vgl. ebda., S. 305–307.<br />
203 Ebda.<br />
204 Ebda., S. 315.<br />
205 Vgl. ebda.<br />
206 „Wenn es um Integration geht, sind die Migrant/innen in den letzten Jahren die am meisten untersuchte Gruppe,<br />
und auch wenn sie in diesen Untersuchungen nicht mehr Auslän<strong>der</strong> genannt werden, ist man sich doch insgeheim<br />
sicher, dass sie es sind. Sie haben Auskunft zu geben über ihre Bildungsbiografien, ihre kulturellen und<br />
religiösen Identitäten, über ihre Auffassungen von Staat, Demokratie und Abendland.“ Messerschmidt, Weltbil<strong>der</strong><br />
und Selbstbil<strong>der</strong>, S. 88.<br />
65