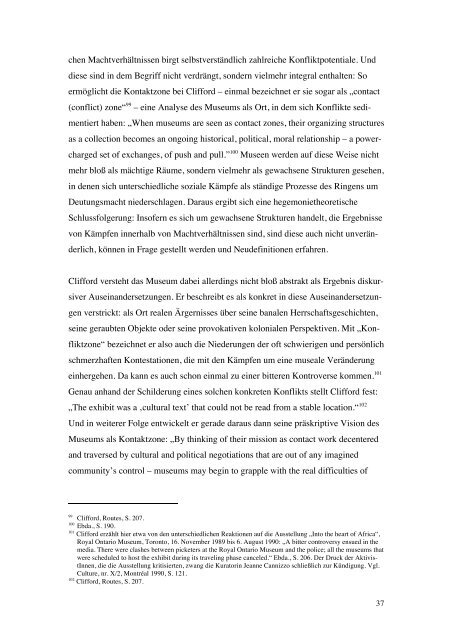Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
chen Machtverhältnissen birgt selbstverständlich zahlreiche Konfliktpotentiale. Und<br />
diese sind in dem Begriff nicht verdrängt, son<strong>der</strong>n vielmehr integral enthalten: So<br />
ermöglicht die Kontaktzone bei Clifford – einmal bezeichnet er sie sogar als „contact<br />
(conflict) zone“ 99 – eine Analyse des Museums als Ort, in dem sich Konflikte sedimentiert<br />
haben: „When museums are seen as contact zones, their organizing structures<br />
as a collection becomes an ongoing historical, political, moral relationship – a powercharged<br />
set of exchanges, of push and pull.” 100 Museen werden auf diese Weise nicht<br />
mehr bloß als mächtige Räume, son<strong>der</strong>n vielmehr als gewachsene Strukturen gesehen,<br />
in denen sich unterschiedliche soziale Kämpfe als ständige Prozesse des Ringens um<br />
Deutungsmacht nie<strong>der</strong>schlagen. Daraus ergibt sich eine hegemonietheoretische<br />
Schlussfolgerung: Insofern es sich um gewachsene Strukturen handelt, die Ergebnisse<br />
von Kämpfen innerhalb von Machtverhältnissen sind, sind diese auch nicht unverän<strong>der</strong>lich,<br />
können in Frage gestellt werden und Neudefinitionen erfahren.<br />
Clifford versteht das Museum dabei allerdings nicht bloß abstrakt als Ergebnis diskursiver<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzungen. Er beschreibt es als konkret in diese Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
verstrickt: als Ort realen Ärgernisses über seine banalen Herrschaftsgeschichten,<br />
seine geraubten Objekte o<strong>der</strong> seine provokativen kolonialen Perspektiven. Mit „Konfliktzone“<br />
bezeichnet er also auch die Nie<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> oft schwierigen und persönlich<br />
schmerzhaften Kontestationen, die mit den Kämpfen um eine museale Verän<strong>der</strong>ung<br />
einhergehen. Da kann es auch schon einmal zu einer bitteren Kontroverse kommen. 101<br />
Genau anhand <strong>der</strong> Schil<strong>der</strong>ung eines solchen konkreten Konflikts stellt Clifford fest:<br />
„The exhibit was a ‚cultural text’ that could not be read from a stable location.“ 102<br />
Und in weiterer Folge entwickelt er gerade daraus dann seine präskriptive Vision des<br />
Museums als Kontaktzone: „By thinking of their mission as contact work decentered<br />
and traversed by cultural and political negotiations that are out of any imagined<br />
community’s control – museums may begin to grapple with the real difficulties of<br />
99<br />
Clifford, Routes, S. 207.<br />
100 Ebda., S. 190.<br />
101 Clifford erzählt hier etwa von den unterschiedlichen Reaktionen auf die Ausstellung „Into the heart of Africa“,<br />
Royal Ontario Museum, Toronto, 16. November 1989 bis 6. August 1990: „A bitter controversy ensued in the<br />
media. There were clashes between picketers at the Royal Ontario Museum and the police; all the museums that<br />
were scheduled to host the exhibit during its traveling phase canceled.“ Ebda., S. 206. Der Druck <strong>der</strong> AktivistInnen,<br />
die die Ausstellung kritisierten, zwang die Kuratorin Jeanne Cannizzo schließlich zur Kündigung. Vgl.<br />
Culture, nr. X/2, Montréal 1990, S. 121.<br />
102 Clifford, Routes, S. 207.<br />
37