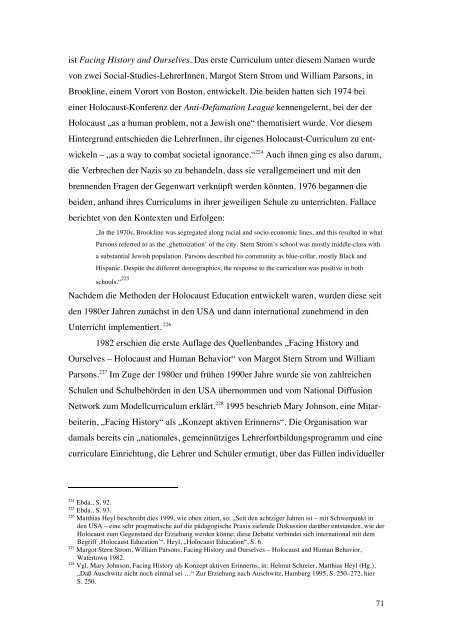Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ist Facing History and Ourselves. Das erste Curriculum unter diesem Namen wurde<br />
von zwei Social-Studies-LehrerInnen, Margot Stern Strom und William Parsons, in<br />
Brookline, einem Vorort von Boston, entwickelt. Die beiden hatten sich 1974 bei<br />
einer Holocaust-Konferenz <strong>der</strong> Anti-Defamation League kennengelernt, bei <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Holocaust „as a human problem, not a Jewish one“ thematisiert wurde. Vor diesem<br />
Hintergrund entschieden die LehrerInnen, ihr eigenes Holocaust-Curriculum zu entwickeln<br />
– „as a way to combat societal ignorance.“ 224 Auch ihnen ging es also darum,<br />
die Verbrechen <strong>der</strong> Nazis so zu behandeln, dass sie verallgemeinert und mit den<br />
brennenden Fragen <strong>der</strong> Gegenwart verknüpft werden könnten. 1976 begannen die<br />
beiden, anhand ihres Curriculums in ihrer jeweiligen Schule zu unterrichten. Fallace<br />
berichtet von den Kontexten und Erfolgen:<br />
„In the 1970s, Brookline was segregated along racial and socio-economic lines, and this resulted in what<br />
Parsons referred to as the ‚ghettoization’ of the city. Stern Strom’s school was mostly middle-class with<br />
a substantial Jewish population. Parsons described his community as blue-collar, mostly Black and<br />
Hispanic. Despite the different demographics, the response to the curriculum was positive in both<br />
schools.“ 225<br />
Nachdem die Methoden <strong>der</strong> Holocaust Education entwickelt waren, wurden diese seit<br />
den 1980er Jahren zunächst in den USA und dann international zunehmend in den<br />
Unterricht implementiert. 226<br />
1982 erschien die erste Auflage des Quellenbandes „Facing History and<br />
Ourselves – Holocaust and Human Behavior“ von Margot Stern Strom und William<br />
Parsons. 227 Im Zuge <strong>der</strong> 1980er und frühen 1990er Jahre wurde sie von zahlreichen<br />
Schulen und Schulbehörden in den USA übernommen und vom National Diffusion<br />
Network zum Modellcurriculum erklärt. 228 1995 beschrieb Mary Johnson, eine Mitarbeiterin,<br />
„Facing History“ als „Konzept aktiven Erinnerns“. Die Organisation war<br />
damals bereits ein „nationales, gemeinnütziges Lehrerfortbildungsprogramm und eine<br />
curriculare Einrichtung, die Lehrer und Schüler ermutigt, über das Fällen individueller<br />
224 Ebda., S. 92.<br />
225 Ebda., S. 93.<br />
226 Matthias Heyl beschreibt dies 1999, wie oben zitiert, so: „Seit den achtziger Jahren ist – mit Schwerpunkt in<br />
den USA – eine sehr pragmatische auf die pädagogische Praxis zielende Diskussion darüber entstanden, wie <strong>der</strong><br />
Holocaust zum Gegenstand <strong>der</strong> Erziehung werden könne; diese Debatte verbindet sich international mit dem<br />
Begriff ‚Holocaust Education’“. Heyl, „Holocaust Education“, S. 6.<br />
227 Margot Stern Strom, William Parsons, Facing History and Ourselves – Holocaust and Human Behavior,<br />
Watertown 1982.<br />
228 Vgl. Mary Johnson, Facing History als Konzept aktiven Erinnerns, in: Helmut Schreier, Matthias Heyl (Hg.),<br />
„Daß Auschwitz nicht noch einmal sei …“ Zur Erziehung nach Auschwitz, Hamburg 1995, S. 250–272, hier<br />
S. 250.<br />
71