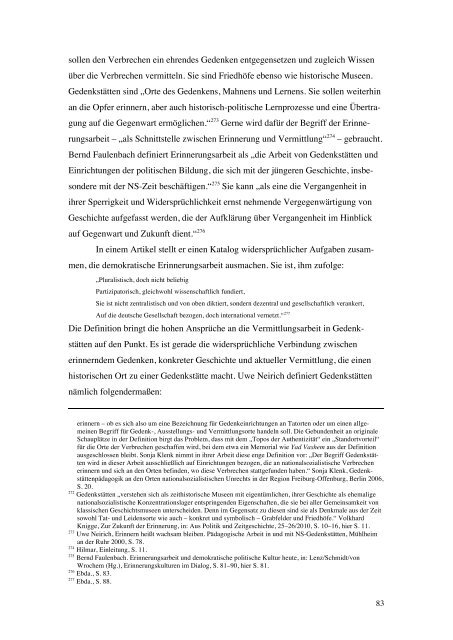Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sollen den Verbrechen ein ehrendes Gedenken entgegensetzen und zugleich Wissen<br />
über die Verbrechen vermitteln. Sie sind Friedhöfe ebenso wie historische Museen.<br />
Gedenkstätten sind „Orte des Gedenkens, Mahnens und <strong>Lernen</strong>s. Sie sollen weiterhin<br />
an die Opfer erinnern, aber auch historisch-politische Lernprozesse und eine Übertragung<br />
auf die Gegenwart ermöglichen.“ 273 Gerne wird dafür <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Erinnerungsarbeit<br />
– „als Schnittstelle zwischen Erinnerung und Vermittlung“ 274 – gebraucht.<br />
Bernd Faulenbach definiert Erinnerungsarbeit als „die Arbeit von Gedenkstätten und<br />
Einrichtungen <strong>der</strong> politischen Bildung, die sich mit <strong>der</strong> jüngeren Geschichte, insbeson<strong>der</strong>e<br />
mit <strong>der</strong> NS-Zeit beschäftigen.“ 275 Sie kann „als eine die Vergangenheit in<br />
ihrer Sperrigkeit und Wi<strong>der</strong>sprüchlichkeit ernst nehmende Vergegenwärtigung von<br />
Geschichte aufgefasst werden, die <strong>der</strong> Aufklärung über Vergangenheit im Hinblick<br />
auf Gegenwart und Zukunft dient.“ 276<br />
In einem Artikel stellt er einen Katalog wi<strong>der</strong>sprüchlicher Aufgaben zusammen,<br />
die demokratische Erinnerungsarbeit ausmachen. Sie ist, ihm zufolge:<br />
„Pluralistisch, doch nicht beliebig<br />
Partizipatorisch, gleichwohl wissenschaftlich fundiert,<br />
Sie ist nicht zentralistisch und von oben diktiert, son<strong>der</strong>n dezentral und gesellschaftlich verankert,<br />
Auf die deutsche Gesellschaft bezogen, doch international vernetzt.“ 277<br />
Die Definition bringt die hohen Ansprüche an die Vermittlungsarbeit in Gedenkstätten<br />
auf den Punkt. Es ist gerade die wi<strong>der</strong>sprüchliche Verbindung zwischen<br />
erinnerndem Gedenken, konkreter Geschichte und aktueller Vermittlung, die einen<br />
historischen Ort zu einer Gedenkstätte macht. Uwe Neirich definiert Gedenkstätten<br />
nämlich folgen<strong>der</strong>maßen:<br />
erinnern – ob es sich also um eine Bezeichnung für Gedenkeinrichtungen an Tatorten o<strong>der</strong> um einen allgemeinen<br />
Begriff für Gedenk-, Ausstellungs- und Vermittlungsorte handeln soll. Die Gebundenheit an originale<br />
Schauplätze in <strong>der</strong> Definition birgt das Problem, dass mit dem „Topos <strong>der</strong> Authentizität“ ein „Standortvorteil“<br />
für die Orte <strong>der</strong> Verbrechen geschaffen wird, bei dem etwa ein Memorial wie Yad Vashem aus <strong>der</strong> Definition<br />
ausgeschlossen bleibt. Sonja Klenk nimmt in ihrer Arbeit diese enge Definition vor: „Der Begriff Gedenkstätten<br />
wird in dieser Arbeit ausschließlich auf Einrichtungen bezogen, die an nationalsozialistische Verbrechen<br />
erinnern und sich an den Orten befinden, wo diese Verbrechen stattgefunden haben.“ Sonja Klenk, Gedenkstättenpädagogik<br />
an den Orten nationalsozialistischen Unrechts in <strong>der</strong> Region Freiburg-Offenburg, Berlin 2006,<br />
S. 20.<br />
272 Gedenkstätten „verstehen sich als zeithistorische Museen mit eigentümlichen, ihrer Geschichte als ehemalige<br />
nationalsozialistische Konzentrationslager entspringenden Eigenschaften, die sie bei aller Gemeinsamkeit von<br />
klassischen Geschichtsmuseen unterscheiden. Denn im Gegensatz zu diesen sind sie als Denkmale aus <strong>der</strong> Zeit<br />
sowohl Tat- und Leidensorte wie auch – konkret und symbolisch – Grabfel<strong>der</strong> und Friedhöfe.“ Volkhard<br />
Knigge, Zur Zukunft <strong>der</strong> Erinnerung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 25–26/2010, S. 10–16, hier S. 11.<br />
273 Uwe Neirich, Erinnern heißt wachsam bleiben. Pädagogische Arbeit in und mit NS-Gedenkstätten, Mühlheim<br />
an <strong>der</strong> Ruhr 2000, S. 78.<br />
274 Hilmar, Einleitung, S. 11.<br />
275 Bernd Faulenbach. Erinnerungsarbeit und demokratische politische Kultur heute, in: Lenz/Schmidt/von<br />
Wrochem (Hg.), Erinnerungskulturen im Dialog, S. 81–90, hier S. 81.<br />
276 Ebda., S. 83.<br />
277 Ebda., S. 88.<br />
83