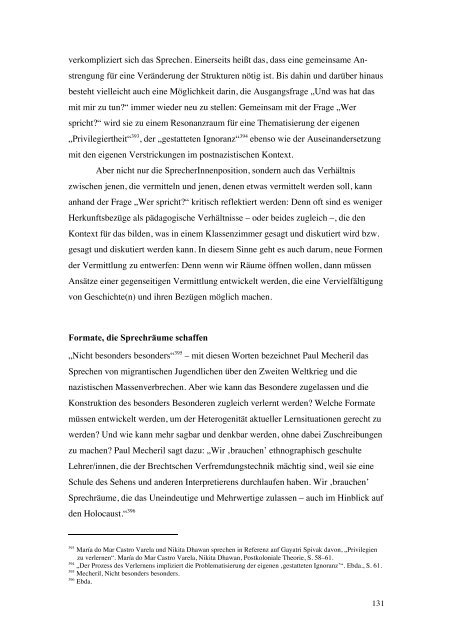Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
verkompliziert sich das Sprechen. Einerseits heißt das, dass eine gemeinsame Anstrengung<br />
für eine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Strukturen nötig ist. Bis dahin und darüber hinaus<br />
besteht vielleicht auch eine Möglichkeit darin, die Ausgangsfrage „Und was hat das<br />
mit mir zu tun?“ immer wie<strong>der</strong> neu zu stellen: Gemeinsam mit <strong>der</strong> Frage „Wer<br />
spricht?“ wird sie zu einem Resonanzraum für eine Thematisierung <strong>der</strong> eigenen<br />
„Privilegiertheit“ 393 , <strong>der</strong> „gestatteten Ignoranz“ 394 ebenso wie <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit den eigenen Verstrickungen im postnazistischen Kontext.<br />
Aber nicht nur die SprecherInnenposition, son<strong>der</strong>n auch das Verhältnis<br />
zwischen jenen, die vermitteln und jenen, denen etwas vermittelt werden soll, kann<br />
anhand <strong>der</strong> Frage „Wer spricht?“ kritisch reflektiert werden: Denn oft sind es weniger<br />
Herkunftsbezüge als pädagogische Verhältnisse – o<strong>der</strong> beides zugleich –, die den<br />
Kontext für das bilden, was in einem Klassenzimmer gesagt und diskutiert wird bzw.<br />
gesagt und diskutiert werden kann. In diesem Sinne geht es auch darum, neue Formen<br />
<strong>der</strong> Vermittlung zu entwerfen: Denn wenn wir Räume öffnen wollen, dann müssen<br />
Ansätze einer gegenseitigen Vermittlung entwickelt werden, die eine Vervielfältigung<br />
von Geschichte(n) und ihren Bezügen möglich machen.<br />
Formate, die Sprechräume schaffen<br />
„Nicht beson<strong>der</strong>s beson<strong>der</strong>s“ 395 – mit diesen Worten bezeichnet Paul Mecheril das<br />
Sprechen von migrantischen Jugendlichen über den Zweiten Weltkrieg und die<br />
nazistischen Massenverbrechen. Aber wie kann das Beson<strong>der</strong>e zugelassen und die<br />
Konstruktion des beson<strong>der</strong>s Beson<strong>der</strong>en zugleich verlernt werden? Welche Formate<br />
müssen entwickelt werden, um <strong>der</strong> Heterogenität aktueller Lernsituationen gerecht zu<br />
werden? Und wie kann mehr sagbar und denkbar werden, ohne dabei Zuschreibungen<br />
zu machen? Paul Mecheril sagt dazu: „Wir ‚brauchen’ ethnographisch geschulte<br />
Lehrer/innen, die <strong>der</strong> Brechtschen Verfremdungstechnik mächtig sind, weil sie eine<br />
Schule des Sehens und an<strong>der</strong>en Interpretierens durchlaufen haben. Wir ‚brauchen’<br />
Sprechräume, die das Uneindeutige und Mehrwertige zulassen – auch im Hinblick auf<br />
den Holocaust.“ 396<br />
393 María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan sprechen in Referenz auf Gayatri Spivak davon, „Privilegien<br />
zu verlernen“. María do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan, Postkoloniale Theorie, S. 58–61.<br />
394 „Der Prozess des Verlernens impliziert die Problematisierung <strong>der</strong> eigenen ‚gestatteten Ignoranz’“. Ebda., S. 61.<br />
395 Mecheril, Nicht beson<strong>der</strong>s beson<strong>der</strong>s.<br />
396 Ebda.<br />
131