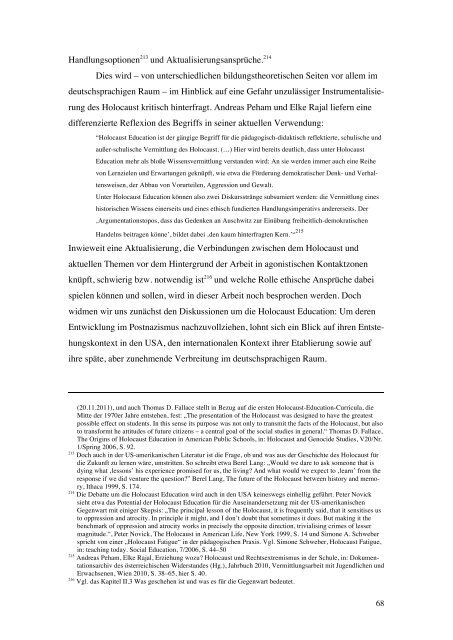Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Handlungsoptionen 213 und Aktualisierungsansprüche. 214<br />
Dies wird – von unterschiedlichen bildungstheoretischen Seiten vor allem im<br />
deutschsprachigen Raum – im Hinblick auf eine Gefahr unzulässiger Instrumentalisierung<br />
des Holocaust kritisch hinterfragt. Andreas Peham und Elke Rajal liefern eine<br />
differenzierte Reflexion des Begriffs in seiner aktuellen Verwendung:<br />
“Holocaust Education ist <strong>der</strong> gängige Begriff für die pädagogisch-didaktisch reflektierte, schulische und<br />
außer-schulische Vermittlung des Holocaust. (…) Hier wird bereits deutlich, dass unter Holocaust<br />
Education mehr als bloße Wissensvermittlung verstanden wird: An sie werden immer auch eine Reihe<br />
von Lernzielen und Erwartungen geknüpft, wie etwa die För<strong>der</strong>ung demokratischer Denk- und Verhaltensweisen,<br />
<strong>der</strong> Abbau von Vorurteilen, Aggression und Gewalt.<br />
Unter Holocaust Education können also zwei Diskursstränge subsumiert werden: die Vermittlung eines<br />
historischen Wissens einerseits und eines ethisch fundierten Handlungsimperativs an<strong>der</strong>erseits. Der<br />
‚Argumentationstopos, dass das Gedenken an Auschwitz zur Einübung freiheitlich-demokratischen<br />
Handelns beitragen könne’, bildet dabei ‚den kaum hinterfragten Kern.’“ 215<br />
Inwieweit eine Aktualisierung, die Verbindungen zwischen dem Holocaust und<br />
aktuellen Themen vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Arbeit in agonistischen <strong>Kontaktzonen</strong><br />
knüpft, schwierig bzw. notwendig ist 216 und welche Rolle ethische Ansprüche dabei<br />
spielen können und sollen, wird in dieser Arbeit noch besprochen werden. Doch<br />
widmen wir uns zunächst den Diskussionen um die Holocaust Education: Um <strong>der</strong>en<br />
Entwicklung im Postnazismus nachzuvollziehen, lohnt sich ein Blick auf ihren Entstehungskontext<br />
in den USA, den internationalen Kontext ihrer Etablierung sowie auf<br />
ihre späte, aber zunehmende Verbreitung im deutschsprachigen Raum.<br />
(20.11.2011), und auch Thomas D. Fallace stellt in Bezug auf die ersten Holocaust-Education-Curricula, die<br />
Mitte <strong>der</strong> 1970er Jahre entstehen, fest: „The presentation of the Holocaust was designed to have the greatest<br />
possible effect on students. In this sense its purpose was not only to transmit the facts of the Holocaust, but also<br />
to transformt he attitudes of future citizens – a central goal of the social studies in general.“ Thomas D. Fallace,<br />
The Origins of Holocaust Education in American Public Schools, in: Holocaust and Genocide Studies, V20/Nr.<br />
1/Spring 2006, S. 92.<br />
213 Doch auch in <strong>der</strong> US-amerikanischen Literatur ist die Frage, ob und was aus <strong>der</strong> Geschichte des Holocaust für<br />
die Zukunft zu lernen wäre, umstritten. So schreibt etwa Berel Lang: „Would we dare to ask someone that is<br />
dying what ‚lessons’ his experience promised for us, the living? And what would we expect to ‚learn’ from the<br />
response if we did venture the question?” Berel Lang, The future of the Holocaust between history and memory,<br />
Ithaca 1999, S. 174.<br />
214 Die Debatte um die Holocaust Education wird auch in den USA keineswegs einhellig geführt. Peter Novick<br />
sieht etwa das Potential <strong>der</strong> Holocaust Education für die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> US-amerikanischen<br />
Gegenwart mit einiger Skepsis: „The principal lesson of the Holocaust, it is frequently said, that it sensitises us<br />
to oppression and atrocity. In principle it might, and I don’t doubt that sometimes it does. But making it the<br />
benchmark of oppression and atrocity works in precisely the opposite direction, trivialising crimes of lesser<br />
magnitude.“, Peter Novick, The Holocaust in American Life, New York 1999, S. 14 und Simone A. Schweber<br />
spricht von einer „Holocaust Fatigue“ in <strong>der</strong> pädagogischen Praxis. Vgl. Simone Schweber, Holocaust Fatigue,<br />
in: teaching today. Social Education, 7/2006, S. 44–50<br />
215 Andreas Peham, Elke Rajal, Erziehung wozu? Holocaust und Rechtsextremismus in <strong>der</strong> Schule, in: Dokumentationsarchiv<br />
des österreichischen Wi<strong>der</strong>standes (Hg.), Jahrbuch 2010, Vermittlungsarbeit mit Jugendlichen und<br />
Erwachsenen, Wien 2010, S. 38–65, hier S. 40.<br />
216 Vgl. das Kapitel II.3 Was geschehen ist und was es für die Gegenwart bedeutet.<br />
68