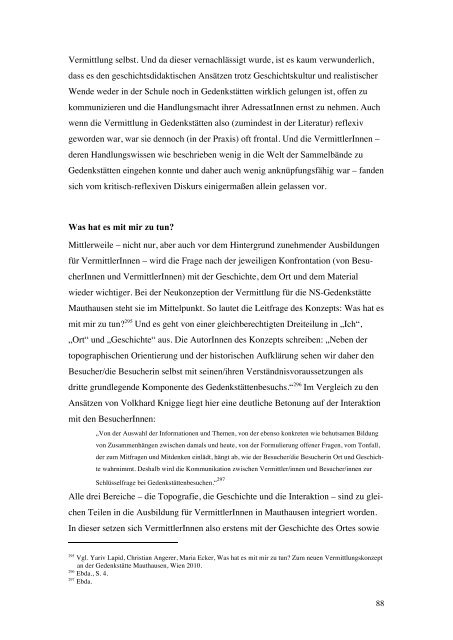Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung Transnationales Lernen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vermittlung selbst. Und da dieser vernachlässigt wurde, ist es kaum verwun<strong>der</strong>lich,<br />
dass es den geschichtsdidaktischen Ansätzen trotz Geschichtskultur und realistischer<br />
Wende we<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Schule noch in Gedenkstätten wirklich gelungen ist, offen zu<br />
kommunizieren und die Handlungsmacht ihrer AdressatInnen ernst zu nehmen. Auch<br />
wenn die Vermittlung in Gedenkstätten also (zumindest in <strong>der</strong> Literatur) reflexiv<br />
geworden war, war sie dennoch (in <strong>der</strong> Praxis) oft frontal. Und die VermittlerInnen –<br />
<strong>der</strong>en Handlungswissen wie beschrieben wenig in die Welt <strong>der</strong> Sammelbände zu<br />
Gedenkstätten eingehen konnte und daher auch wenig anknüpfungsfähig war – fanden<br />
sich vom kritisch-reflexiven Diskurs einigermaßen allein gelassen vor.<br />
Was hat es mit mir zu tun?<br />
Mittlerweile – nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund zunehmen<strong>der</strong> Ausbildungen<br />
für VermittlerInnen – wird die Frage nach <strong>der</strong> jeweiligen Konfrontation (von BesucherInnen<br />
und VermittlerInnen) mit <strong>der</strong> Geschichte, dem Ort und dem Material<br />
wie<strong>der</strong> wichtiger. Bei <strong>der</strong> Neukonzeption <strong>der</strong> Vermittlung für die NS-Gedenkstätte<br />
Mauthausen steht sie im Mittelpunkt. So lautet die Leitfrage des Konzepts: Was hat es<br />
mit mir zu tun? 295 Und es geht von einer gleichberechtigten Dreiteilung in „Ich“,<br />
„Ort“ und „Geschichte“ aus. Die AutorInnen des Konzepts schreiben: „Neben <strong>der</strong><br />
topographischen Orientierung und <strong>der</strong> historischen Aufklärung sehen wir daher den<br />
Besucher/die Besucherin selbst mit seinen/ihren Verständnisvoraussetzungen als<br />
dritte grundlegende Komponente des Gedenkstättenbesuchs.“ 296 Im Vergleich zu den<br />
Ansätzen von Volkhard Knigge liegt hier eine deutliche Betonung auf <strong>der</strong> Interaktion<br />
mit den BesucherInnen:<br />
„Von <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> Informationen und Themen, von <strong>der</strong> ebenso konkreten wie behutsamen Bildung<br />
von Zusammenhängen zwischen damals und heute, von <strong>der</strong> Formulierung offener Fragen, vom Tonfall,<br />
<strong>der</strong> zum Mitfragen und Mitdenken einlädt, hängt ab, wie <strong>der</strong> Besucher/die Besucherin Ort und Geschichte<br />
wahrnimmt. Deshalb wird die Kommunikation zwischen Vermittler/innen und Besucher/innen zur<br />
Schlüsselfrage bei Gedenkstättenbesuchen.“ 297<br />
Alle drei Bereiche – die Topografie, die Geschichte und die Interaktion – sind zu gleichen<br />
Teilen in die Ausbildung für VermittlerInnen in Mauthausen integriert worden.<br />
In dieser setzen sich VermittlerInnen also erstens mit <strong>der</strong> Geschichte des Ortes sowie<br />
295 Vgl. Yariv Lapid, Christian Angerer, Maria Ecker, Was hat es mit mir zu tun? Zum neuen Vermittlungskonzept<br />
an <strong>der</strong> Gedenkstätte Mauthausen, Wien 2010.<br />
296 Ebda., S. 4.<br />
297 Ebda.<br />
88