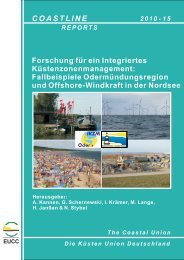Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
III Entwicklungskonzeption<br />
Die Landschaftszone weist durchschnittlich nur mittlere Flächengrößen hinsichtlich unzerschnittener<br />
Freiräume auf. Verantwortlich für die Gesamtbelastung, insbesondere für die höheren Bauflächenanteile<br />
und Erschließungsgrade sind die Küsten- und Hafenstädte mit ihrem Umland sowie die teilweise<br />
intensive touristische Nutzung. Größere unbebaute und unzerschnittene Landschaftsräume befinden<br />
sich noch im Bereich der Rostocker Heide, der Halbinsel Zingst, West- (und Süd-) rügen, Zieseniederung<br />
sowie im Bereich der südlichen Oderhaffregion. Da die Landschaftsausstattung der wichtigste<br />
Kapitalstock für die touristische Nutzung darstellt, sollten weitere Freiraumbeanspruchungen durch<br />
Bauflächen und Verkehrstrassen vermieden werden.<br />
Wasserflächen der Küste und Bodden sollten von technischen Bauwerken weitgehend freigehalten<br />
werden.<br />
2 Vorpommersches Flachland<br />
In dieser Landschaftszone konzentriert sich die Mehrzahl der großflächigen unzerschnittenen Freiräume.<br />
Hervorzuheben sind insbesondere die großflächigen Niederungsgebiete von Recknitz, Trebel,<br />
Peene, Tollense, Landgraben und Zarow mit Friedländer Großen Wiese sowie die großflächigen<br />
Waldgebiete im südlichen Umland von Stralsund und in der Ueckermünder Heide. Der bestehende<br />
konsistente Freiraumverbund sollte erhalten werden.<br />
3 Rückland der Seenplatte<br />
Im Rückland der Seenplatte setzt sich der Verbund großflächiger unzerschnittener Freiräume fort.<br />
Dies betrifft die Niederungen des Recknitz-Augrabensystems, der Peene, des Tollense-<br />
Landgrabensystems, der Uecker und Randow. Hinzu kommt die Warnowniederung und eine Reihe<br />
ländlich geprägter Räume in den Naturräumen Warnow-Recknitz-Gebiet, Teterower-Malchiner-<br />
Becken, Woldegk-Feldberger-Hügelland und Ueckermärkisches Hügelland. Dieses kohärente System<br />
der zerschneidungsarmen Freiräume sollte gesichert und entwickelt werden.<br />
4 Höhenrücken und Seenplatte<br />
Die Landschaftszone weist großflächige unzerschnittene Freiräume im Bereich der Groß- und Kleinseenplatte<br />
auf. In diesen Landschaftsräumen korrelieren hohe landschaftliche Raumqualitäten mit<br />
Rückzugsräumen störungssensibler Tierarten mit großen Raumansprüchen. Die weitere Entwicklung<br />
des touristischen Potentials muss daher mit großer Sorgfalt erfolgen. Ähnliches gilt für die Schaalseeregion.<br />
Die großflächigen unzerschnittenen Freiräume nordöstlich des Schweriner Sees sind durch<br />
den Bau der A 241 gefährdet. Wanderkorridore für wandernde Tierarten sollten erhalten und wiederhergestellt<br />
werden.<br />
5 Südwestliches Vorland der Seenplatte und 6 Elbetal<br />
Die Landschaftszone weist im Bereich der südwestlichen Altmoränen und Sander sowie im Bereich<br />
der Niederungen von Elde, Sude und Lewitz sowie der Parchim-Meyenburger Sand- und Lehmflächen<br />
noch großflächige unzerschnittene Freiräume auf. Besondere räumliche Schwerpunkte von Erhaltungs-<br />
und Entwicklungsmaßnahmen sind wegen ihrer Biotopverbundfunktion die Niederungsgebiete,<br />
zu der auch die Elbniederung gehört. Die zusammenhängenden Waldflächen sollten vor Zerschneidungen<br />
bewahrt werden.<br />
2.7 Zusammenfassung für die Landschaftszonen<br />
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ziele zum Schutz und zur Entwicklung der einzelnen Naturgüter<br />
sowie der landschaftlichen Freiräume ergibt sich aus folgender Tabelle 44.<br />
Bei den wichtigsten qualitativen Zielformulierungen wird wie mehrfach dargestellt unterschieden<br />
zwischen Maßnahmen zur Sicherung (S) und zur Entwicklung (E) sowie zum Schutz vor Beeinträchtigungen<br />
(B).<br />
08.03 159