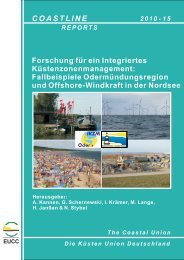Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
III Entwicklungskonzeption<br />
3. Maßnahmen (Handlungskonzept)<br />
Die Umsetzung ist durch § 19 LNatG, welcher die Errichtung von baulichen Anlagen in einem Küstenschutzstreifen<br />
von 200 m land- und seewärts untersagt, und durch § 89 LWaG, welcher die Bebauung<br />
an der Küste einschränkt, gegeben.<br />
Zusätzlich zu dem generellen Küstenschutzstreifen sieht diese Empfehlung vor, dass eine Zone von<br />
mindestens drei Kilometern landwärts der Mittelwasserlinie als Küstenplanungszone eingerichtet<br />
wird. In dieser Planungszone sollen die Auswirkungen großräumiger Eingriffe in Natur und Landschaft<br />
zuvor in einem Landnutzungsplan beurteilt werden.<br />
Instrumente zur Umsetzung dieser Forderungen sind die Gutachtlichen Landschaftsrahmenpläne und<br />
die Regionalen Raumordnungsprogramme.<br />
Umsetzung durch Kompensation im Rahmen der Eingriffsregelung<br />
Die Eingriffsregelung kann durch eine mit den Zielsetzungen abgestimmte Auswahl von Kompensationsmaßnahmen<br />
Möglichkeiten zur Regeneration beeinträchtiger Salzgraslandstandorte bieten. So<br />
sollen Maßnahmen zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes in Feuchtgebieten nach<br />
landesweiter Vorgabe bei der Auswahl von Kompensationsmaßnahmen im Zuge der Eingriffsregelung<br />
vorrangig berücksichtigt werden.<br />
Für die Landschaftszone „Ostseeküste“ wird die Wiederherstellung von Küstenüberflutungsbereichen<br />
mit dem Biotoptyp „Salzgrasland“ als ein Kompensationsschwerpunkt genannt (vgl. Kap. III-3.1.2.1).<br />
Projektförderung, Flächenkauf: Moorschutzkonzept<br />
Der Schutz und die Entwicklung von Küstenüberflutungsmooren kann über das Moorschutzkonzept<br />
umgesetzt werden (vgl. III.3.1.2.1). Flächen, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können,<br />
sollen erworben werden. Salzgrasland soll jedoch vorrangig beweidet werden.<br />
Vertragsnaturschutz: Naturschutzgerechte Grünlandnutzung<br />
Für die pflegende Bewirtschaftung von Salzweiden bietet das Förderprogramm „Naturschutzgerechte<br />
Grünlandnutzung“ mit dem Programmtyp „Salzgrasland“ geeignete Voraussetzungen (vgl. Kap. III-<br />
3.1.2.1). Gebiete mit ornithologischer Bedeutung müssen ausreichend groß sein und der Einfluss von<br />
Beutegreifern muss beherrschbar sein.<br />
3.1.1.3 Rastplatzfunktion der Küstengewässer für Vogelarten<br />
Küstengewässern kommt weiträumig eine besonders hohe Bedeutung, sowohl für die Überwinterungsperiode<br />
(Eintreffen im Herbst bis Heimzug im Frühjahr), den Frühjahrszug sowie die Mauserund<br />
Herbstzugperiode (Rast- und Zugvögel). Der Greifswalder Bodden und die Pommersche Bucht<br />
sind die wichtigsten Überwinterungsgebiete im deutschen Ostseeraum. Die Oderbank gehört darüber<br />
hinaus zu den zehn wichtigsten Überwinterungsgebieten für Meeresvögel im gesamten Ostseeraum 1 .<br />
Bedeutung der Küstengewässer für die ökologischen Gruppen 2 :<br />
− Seetaucher und Lappentaucher erreichen v.a. in den nördlichen und östlichen Wieken Rügens und in der<br />
Pommerschen Bucht international bedeutsame Konzentrationen.<br />
− Alken und Lummen haben ihren Schwerpunkt im zentralen Teil der Ostsee.<br />
− Tauchenten und Säger, die individuenstärkste Gruppe rastender Vögel, sind die Charaktervögel flacher<br />
Gewässer der Bodden und großen Buchten. International bedeutsame Konzentrationen finden sich v.a. in<br />
der Pommerschen Bucht, an der pommerschen Boddenküste und in der Wismarbucht.<br />
− Schwäne, Gänse, Schwimmenten, Kraniche und Rallen nutzen (neben Binnengewässern, vgl. Kap. III-<br />
3.1.3.4) sehr flache, v.a. ufernahe Küstengewässer. Ihre Nahrung suchen sie zum Teil, teilweise auch ausschließlich,<br />
auf dem Land (vgl. Kap. III-3.1.4.1).<br />
Die Maßnahmen zur Sicherung der Rastplatzfunktion werden in Tab. 48 erläutert.<br />
1 Institut für Angewandte Ökologie (1998), DURINCK et al. (1994), I.L.N. (1996b)<br />
2 I.L.N. (1998)<br />
08.03 173