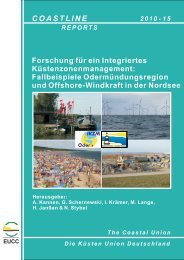Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
II. GRUNDLAGEN<br />
2 DIE NATURGÜTER<br />
nutzung oder Drainage stärker entkalkte Böden sowie Sandböden im Jungmoränenland) oder bereits<br />
kalkärmeres Moränenmaterial (teilweise Endmoränen, Sander, Becken- und Talsandgebiete) vorliegt.<br />
Birken-Stieleichenwälder treten schließlich auf nährstoffarmen Sanden und bei starkem Grundwassereinfluss<br />
in Erscheinung. Häufig dienten diese Standorte früher einmal der Landwirtschaft und waren,<br />
wenn nicht ärmere Äcker, so extensiv übernutzte Waldweiden (Heiden, Hutungen). Auf Standorten<br />
dieses Potenzials ist der Waldanteil heute relativ hoch, doch sind sie zumeist stark forstwirtschaftlich<br />
überformt, weshalb der Anteil naturnaher Wälder gering ist.<br />
Immergrüne Nadelwälder. Der immergrüne Nadelwald ist für die nördlich gelegene boreale Zone<br />
(Taiga) charakteristisch. Südlich davon können Nadelwälder nur auf extremen Standorten natürlich<br />
auftreten. Nur junge, sehr arme und trockene Böden bilden natürliche Standorte für Nadelwald – also<br />
fast ausschließlich Dünen des Binnenlandes und der Küsten, wo Kiefernwald, gemischt mit Laubbaumarten<br />
(besonders Birke, auch Espe und Eiche), als langlebiges Pionierstadium vorkommen kann.<br />
Die hiesigen natürlichen Nadelwaldstandorte werden den subkontinentalen Kiefern-Trockenwäldern<br />
zugerechnet. Alle übrigen Nadelwälder gehen auf forstliche Anlage oder Förderung zurück und stocken<br />
durchweg auf potenziell natürlichen Laubwaldstandorten.<br />
Die natürlichen Nadelwaldstandorte wurden größtenteils durch forstliche Maßnahmen überformt,<br />
wobei jedoch auch hier die Kiefer, natürliche Hauptbaumart dieser Standorte, dominiert. So konnten<br />
am Rande von Kiefernkulturen Elemente naturnaher Dünenwälder ohne Konkurrenz fremder Baumarten<br />
überdauern (z.B. an Wegrändern, bei starkem Dünenrelief, auf militärischen Übungsplätzen und in<br />
lichteren Altbaumbeständen der Küstenheiden). Eine weitere Bedrohung für die Reste naturnaher<br />
Kiefernwälder entsteht jedoch durch das Eindringen nichteinheimischer Gehölze aus Küstenschutzpflanzungen<br />
und durch sogenannte Bodenverbesserer (z.B. Späte Traubenkirsche).<br />
Forsten. Die meisten Wälder sind durch forstliche Nutzung stark beeinflusst, so dass die Bestockung<br />
von der potenziell natürlichen Vegetation vollständig abweicht. Besonders stark ist diese Abweichung<br />
bei den weit verbreiteten Kiefernforsten, die auf armen Sandstandorten dominieren<br />
Altbestände. Neben einer möglichst natürlichen Bestockung gibt es weitere, vorwiegend strukturelle<br />
Merkmale für die Lebensraumqualität der Wälder, die stark von der forstlichen Bewirtschaftung abhängen.<br />
Das Belassen von Totholz in den Beständen, ein hoher Anteil an Altbäumen in altersgemischten<br />
Beständen sowie naturnahe Waldränder sind Voraussetzung für die Existenz. der typischen<br />
Wirbellosen-Lebensgemeinschaften. Ebenso benötigen Vogelarten wie der Seeadler oder Fledermausarten<br />
wie der Abendsegler und das Braune Langohr ausgedehnte alt- und totholzreiche Wälder. Vollkommen<br />
aus der Nutzung genommene Totalwaldreservate können als Rückzugsräume eine große<br />
Bedeutung für die Wiederausbreitung von Tier- und Pflanzenarten des Waldes haben, sofern sie eine<br />
Ausdehnung aufweisen, die eine<br />
natürliche Walddynamik zulässt.<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Laubmischwald,<br />
Feldgehölz<br />
Laubwald,<br />
Mischwald,<br />
Waldrand<br />
Biotop- und Nutzungstypen<br />
Bruthabitate des Zaunkönigs 1<br />
Höhe des<br />
HSI<br />
Nadelmischwald, Kahlschlag,<br />
Baumgruppe,<br />
Hecke, Park, Klein-gärten<br />
Nadelwald, Gebüsch,<br />
Zoo, Friedhof<br />
Als Beispiel für eine charakteristische<br />
Brutvogelart unterholzreicher<br />
Wälder und Feldgehölze kann der<br />
Zaunkönig gelten. In Auswertung<br />
der Biotop- und Nutzungstypenkartierung<br />
und der Kartierung der<br />
Brutvögel 1 wurden zur detaillierten<br />
Beschreibung der Bruthabitate die<br />
einzelnen Biotoptypen nach ihrer<br />
Eignung gewichtet.<br />
Abb. 2: Eignungsindex potenzieller<br />
1 GIS (2000): Darstellung der Brutverbreitung von Zielarten des Naturschutzes.<br />
46<br />
08.03