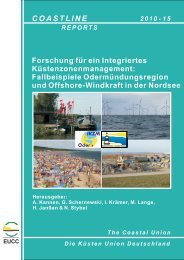Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
II. GRUNDLAGEN<br />
2 DIE NATURGÜTER<br />
det große Teile dieser Frachten in den Gewässersystemen durch Sedimentation. Deshalb erfordert<br />
die Umkehrung von Eutrophierungsprozessen einen außerordentlich hohen Aufwand. Die Entfernung<br />
der Sedimente, neben der obligatorischen Sanierung der Zuflüsse oft für die dauerhafte Verbesserung<br />
des Seestatus erforderlich, greift selbst stark in den Nährstoffhaushalt der Landschaft<br />
ein und kann evtl. im Gewässer noch vorhandene empfindliche Arten gefährden. Ohne Entfernung<br />
der Sedimente muss auch bei gründlicher Sanierung des Einzugsgebietes mit sehr langwierigen<br />
Erholungsprozessen gerechnet werden, bis sich die oberen Sedimente soweit stabilisiert haben,<br />
dass keine wirksame Rücklösung festgelegter Nährstoffe mehr erfolgt. Die bisher bekannten Erfolge<br />
bei der Verbesserung der trophischen Situation größerer Seen (z.B. Müritz von eutroph in<br />
den 1980er zu mesotroph in den 1990er Jahren) werden trotz zahlreicher Maßnahmen in absehbarer<br />
Zeit selten bleiben, da sie stark von besonders günstigen Umständen abhängen. Selbst teilweise<br />
recht intensive Maßnahmen an kleineren Gewässern führen nicht in allen Fällen zum Erfolg<br />
bzw. müssen durch weitere ergänzt werden.<br />
2. Weitere Belastungen und Störungen von Gewässerfunktionen gehen zum einen von Gewässerschadstoffen<br />
aus, darunter auch solchen, bei denen Grenzwerte eingehalten werden (sauerstoffzehrende<br />
Substanzen; Pflanzenbehandlungsmittel mit Wirkung sowohl auf Pflanzen als auch auf<br />
Tiere, Antifoulings, Mineralöle, Schwermetalle einschließlich schwermetallhaltiger organische<br />
Stoffe), außerdem die Abgabe von Wärme an Gewässer.<br />
3. Kleingewässer und Sölle sind von direkter Vernichtung durch Verfüllung und Entwässerung<br />
bedroht.<br />
Darüber hinaus sind punktuell direkte Störungen von besonderer Bedeutung, problematisch sind in<br />
dieser Hinsicht vor allem in bestimmten Jahreszeiten der Sportbootverkehr und das Angeln vom Boot<br />
und von Land.<br />
Lebensraumtypen der Agrarlandschaft<br />
In weiten Teilen wird die Landschaft durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. An der gesamten<br />
landwirtschaftlich genutzten Fläche hat Ackerland einen Anteil von 79 % und Dauergrünland von<br />
knapp 21 % (vgl. Kap. II-1.4).<br />
Für die Betrachtung der nutzungsbedingten Lebensräume ist die Landnutzungsgeschichte maßgeblich.<br />
Im Zuge der nacheiszeitlichen Besiedlung durch den Menschen wanderten zahlreiche Pflanzen- und<br />
Tierarten hier ein oder breiteten sich aus, die das Gebiet nur durch die künstliche Waldfreiheit oder<br />
infolge der Bodenbearbeitung besiedeln konnten. Die über Jahrhunderte währende extensive Landnutzung<br />
hat halbnatürliche Lebensgemeinschaften mit charakteristischer Artenausstattung hervorgebracht,<br />
die Bestandteil unserer heimischen Pflanzen- und Tierwelt geworden sind (vgl. Kap. II-1.3 und<br />
II-1.4). Mit der zunehmend intensiveren Form der Landbewirtschaftung sind in der Folge Pflanzenund<br />
Tierarten der ehemals verbreiteten halbnatürlichen Lebensräume stark zurückgegangen und beschränken<br />
sich heute überwiegend auf Sonderstandorte. Die von den intensiven Bewirtschaftungsformen<br />
ausgehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts durch Stoffausträge sind stark von den<br />
standörtlichen Bedingungen abhängig. Insbesondere auf Grenzertragsböden, auf erosionsgefährdeten<br />
Flächen sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zu Gewässern kann die Belastungssituation durch Nutzungsextensivierung<br />
erheblich verbessert werden.<br />
Neben der Nutzungsform bzw. –intensität sind zur Charakterisierung der Lebensräume der Agrarlandschaft<br />
(vgl. Tab. 27) Nutzungswechsel und Strukturelemente wie Feldhecken- und -gehölze, Lesesteinwälle<br />
und –haufen, Sölle und Kleingewässer (vgl. unter Lebensraumtypen der Standgewässer)<br />
sowie kleinflächige Moore und Sümpfe (vgl. unter Lebensraumtypen der Moore) von Bedeutung.<br />
Ackerflächen. Ackerflächen sind durch regelmäßige Fruchtwechsel charakterisiert. Im Land dominiert<br />
unter den Bedingungen der Europäischen Agrarpolitik der Getreideanbau mit 54 % vor den Ölfrüchten<br />
mit 21 % der Anbaufläche im Jahr 1999. Unter den Marktfruchtarten waren 1999<br />
Winterweizen mit 25 %, Winterraps mit fast 18 % (Raps insgesamt einschl. Energieraps 22,5 %),<br />
Wintergerste mit 12 % und Roggen mit 9 % der Ackerfläche die bedeutendsten. Von Bedeutung für<br />
Naturschutz und Landschaftspflege sind die sowohl markt- als auch subventionsgesteuerten Entwicklungen<br />
der Anbaustruktur im letzten Jahrzehnt: leichte Zunahme des Getreideanbaus bei stärkerer<br />
66<br />
08.03