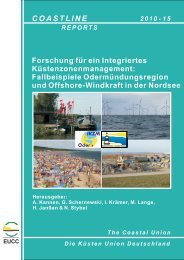Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
III Entwicklungskonzeption<br />
3. Maßnahmen<br />
− Die Erhöhung des durchschnittlichen Nutzungsalters im großen Umfang und langfristige Erntezeiträume<br />
bei der Endnutzung von Buchen-Altbeständen,<br />
− die Vermeidung zu schneller und zu starker Auflichtung bei der Endnutzung von Buchenbeständen,<br />
− der Erhalt von Altholz sowie von Totholz unter angemessener Berücksichtigung der hohen ökologischen<br />
Bedeutung stehenden Totholzes,<br />
- eine Wiedervernässung von in der Vergangenheit entwässerten Moorflächen im Wald (z.B.<br />
Kesselmoore in der Endmoräne). Neue dauerhafte Entwässerungen sind zu unterlassen.<br />
Gesetzlich geschützte Biotope wie Bruch- und Auwälder sind zu erhalten, zu fördern und zu vermehren.<br />
Die Lebensräume bestandsgefährdeter waldbewohnender Arten (nach Tab. 40) sind zu beachten.<br />
Schutzzonen um Horste und Nester störungsempfindlicher Vogelarten gemäß § 36 LNatG sind zu<br />
beachten. Erdaufschlüsse oder Baumstümpfe und Bäume mit Spechthöhlen sollen, ebenso wie Ü-<br />
berhälter als potenzielle Horststandorte für u.a. Fischadler, im Rahmen der Waldpflege nicht beseitigt<br />
werden.<br />
Natürliche Waldränder z.B. an Gewässern sollen als besonders wertvolle Lebensräume ihrer Eigenentwicklung<br />
überlassen werden. Zur funktionsgerechten Gestaltung von Waldrändern als Grenze<br />
zu anderen Nutzungsarten ist ein stufiger Aufbau unter Verwendung standortgerechter,<br />
heimischer Strauch- und Laubbaumarten anzustreben.<br />
Der Schutz und die Wiederausbreitung seltener Baum- und Straucharten auf ihren natürlichen<br />
Standorten sollen gefördert werden (u.a. Ulme, Holzapfel, Holzbirne, Vogelkirsche, Elsbeere, Eibe,<br />
Stechpalme und Wacholder).<br />
Der Waldschutz soll vorrangig durch mechanische und biologische Maßnahmen erfolgen. Weiterhin<br />
soll auf den Einsatz von Bioziden verzichtet werden. Ausnahmen sind nur gegeben, wenn der<br />
Wald durch Schädlingsbefall existentiell gefährdet ist (Gefahrenabwehr).<br />
Durch einen naturverträglichen Waldwegebau, der auf das notwendige Maß beschränkt bleibt, soll<br />
die Bodenversiegelung minimiert werden.<br />
Naturnaher Waldumbau und Waldverjüngung<br />
Alle geeigneten Möglichkeiten der natürlichen Waldverjüngung (Verjüngung durch natürliches<br />
Ansamen im Schutz des Altbestandes) sollen genutzt werden. Eine natürliche Verjüngung muss<br />
dabei gleichermaßen ökologischen und ökonomischen Erfordernissen entsprechen, d.h. auch der<br />
Erzielung hoher und wertvoller lebender Holzvorräte in angemessener Zeit dienen.<br />
Der Waldumbau mit dem Ziel eines höheren Laubwaldanteils, größerer Artenvielfalt und vermehrter<br />
Naturverjüngung erfordert regional eine Reduzierung der Schalenwildbestände. Die Bestände<br />
an Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild müssen so reguliert werden, dass eine Naturverjüngung der<br />
Wälder möglich ist (vgl. Kap. III-3.1.5, Karte V: Schwerpunktbereich Wälder).<br />
Die mit einer naturnahen Bewirtschaftung verbundenen naturschutzfachlichen Anforderungen sollen<br />
für die Landesverwaltung verbindlich sein und werden auch den privaten Waldbesitzern empfohlen.<br />
Für Naturschutzleistungen im Privatwald, welche über die gute fachliche Praxis hinausgehen, sollen<br />
Anreize durch finanzielle Förderung (Vertragsnaturschutz) geschaffen werden (vgl. Kap. III-3.1.5).<br />
Sonderwälder, Wald in Schutzgebieten<br />
Neben den genannten Grundsätzen einer naturnahen Forstwirtschaft als „guter fachlicher Praxis“ gelten<br />
für bestimmte Standorte und Zielsetzungen darüber hinaus gehende Anforderungen:<br />
Waldnaturschutzgebiete sollen dem Schutz natürlicher Waldgesellschaften dienen. Die Vervollständigung<br />
des Schutzgebietssystems (vgl. Kap. III-3.1.5, III-3.1.7.2), das die im Land vorkommenden<br />
Waldgesellschaften repräsentiert, soll auf der Grundlage einer naturräumlichen Analyse<br />
der Waldbestände erfolgen. In den Waldnaturschutzgebieten ist zu unterscheiden zwischen nut-<br />
08.03 245