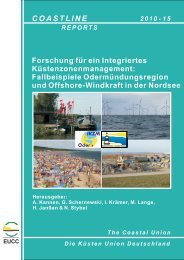Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- L a n d s c h a f t s p r o g r a m m M e c k l e n b u r g – V o r p o m m e r n -<br />
II GRUNDLAGEN<br />
Die Karte 2 gibt die heutige potenziell natürliche Vegetation nach SCAMONI 1 wieder. Auf der Grundlage<br />
der vorliegenden Karten zur Naturraumerkundung im Maßstab 1 : 25.000 der Forstverwaltung<br />
soll künftig die heutige potenziell natürliche Vegetation genauer und in Verbindung mit der bundesweiten<br />
Erarbeitung in der Systematik einheitlich dargestellt werden.<br />
<strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong> ist ursprünglich überwiegend ein Waldland, wobei Buchenmischwald-<br />
Gesellschaften dominieren würden. Infolge des ozeanisch-kontinentalen Klimawandels von Nordwest<br />
nach Südost ist eine Gliederung der Landesfläche in potenziell natürliche Subatlantische Buchenmischwälder<br />
im Norden und Westen sowie Buchenmischwälder des Übergangsbereiches im Südosten<br />
zu verzeichnen (sog. „baltischen Buchenwälder“). Auf den ärmeren Lehm-Sand- und Sand-Böden<br />
treten subatlantische Stieleichen-Buchenwälder auf. Im Süden des Landes im Bereich der Seenplatte<br />
kommen Traubeneichen-Buchenwälder hinzu. In den grundwasserbeeinflussten Sandgebieten (wie<br />
Rostocker und Ueckermünder Heide) herrschen Birken-Stieleichenwälder mit Kiefer vor. In den Flusstälern<br />
und Niederungen mit Niedermooren und Grundwasserböden besteht die potenziell natürliche<br />
Vegetation in Erlen- und Erlen-Eschen-Wäldern und lokalen Birken- und Seggenmooren sowie großflächigen<br />
Röhrichten. Als lokale Besonderheiten und natürlich waldfreie Gebiete sind Regenmoore,<br />
Salz- und Dünengesellschaften hervorzuheben. In der Landschaftszone Elbetal wären Eschen-Ulmenund<br />
Weiden-Pappel-Auenwälder vorzufinden.<br />
1.3 Besiedlung und Bevölkerungsentwicklung<br />
Die heutige Landschaft wird wesentlich durch eine lang andauernde menschliche Nutzung geprägt.<br />
Nur kleine Bereiche entsprechen der potenziell natürlichen Vegetation. Ohne Kenntnis der historischen<br />
Entwicklung lassen sich die aktuellen Erscheinungen nicht erklären., ein kurzer Abriss der Nutzungsgeschichte<br />
ist daher notwendig.<br />
Nach dem Rückzug des Eises vor etwa 10.000 Jahren wanderten langsam Menschen in das Gebiet ein<br />
(Altsteinzeit - Paläolithikum). Von den spärlichen Siedlungsorten zeugen die seltenen Funde. Eine<br />
Bevorzugung der Insel Rügen aufgrund der Feuersteinvorkommen ist jedoch nachzuweisen. Eine ausgedehntere<br />
Besiedlung begann erst im Mesolithikum (7.500 - 4.000 v. Chr.). Das Land war relativ<br />
flächendeckend von nomadisierenden Jägern und Fischern bewohnt, insbesondere in der Nähe von<br />
Gewässern und der Küste. Während dieser Zeit vollzogen sich mit dem Meeresspiegel- und Grundwasseranstieg<br />
gravierende Veränderungen der Natur. Die Entstehung der heutigen Küstenform sowie<br />
der ausgedehnten Moorgebiete und Gewässer begann. Im Neolithikum (4.000 - 1.800 v. Chr.) wurden<br />
die Bewohner sesshaft und betrieben Ackerbau, Viehzucht und Brandrodung sowie Keramik- und<br />
Gewebeherstellung. Die bäuerliche Lebensweise setzte feste Behausungen und damit dörfliche Siedlungsformen<br />
voraus. In der Bronzezeit (1.800 - 600 v. Chr.) blieb die Landwirtschaft die Lebensgrundlage.<br />
Später wurde bei der Geräteherstellung Bronze durch Eisen ersetzt (Eisenzeit), das durch<br />
Raseneisenerz gewonnen wurde. Bis zur Völkerwanderung lebten germanische Stämme in unserem<br />
Landesgebiet. Während der Völkerwanderung (375 - 600) kommt es zu umfangreichen Migrationen<br />
aus dem Ostseeraum nach Süden, so dass die Bevölkerungszahl stark abnahm.<br />
Ab 600 siedelten Slawen, aus östlichen Gebieten kommend, in den bevölkerungsarmen Bereichen des<br />
heutigen <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>. Die Slawen betrieben Ackerbau und Viehzucht und rodeten<br />
Waldbereiche. Trotzdem waren große Landstriche noch weitgehend unbesiedelt.<br />
Im 12. bis 14. Jahrhundert erfolgte die deutsche Kolonisation durch Ostexpansion aus den westelbischen<br />
Gebieten und die Christianisierung der slawischen Bevölkerung. Neben den vorhandenen slawischen<br />
wurden deutsche Siedlungen als Anger-, Platz-, Straßendörfer und Weiler oder mit Rodungen<br />
verbundene Reihendörfer (Hagenhufendorf) gegründet. Die Bevölkerungs- und Landnutzungsintensität<br />
nahmen zu. Als Zentren des Siedlungsnetzes wurden in Abständen einer Tagesreise hauptsächlich<br />
an älteren slawischen Mittelpunkten erste Stadtgründungen im 13. Jahrhundert vorgenommen. Im<br />
Zusammenhang mit der Hanse entwickelte sich ein reges Handelsleben. Die heutige Siedlungsstruktur<br />
wurde in ihren Grundzügen schon im damaligen Zeitraum angelegt. Infolge der umfangreichen Rodungstätigkeit<br />
wurde die landschaftliche Struktur zugunsten von Acker-, Wiesen- und Weideflächen<br />
deutlich verändert.<br />
1 Die Grundlage dieser Darstellung bildet SCAMONI. A. (1981): Karte „Natürliche Vegetation“ 1 : 750.000.<br />
08.03 13