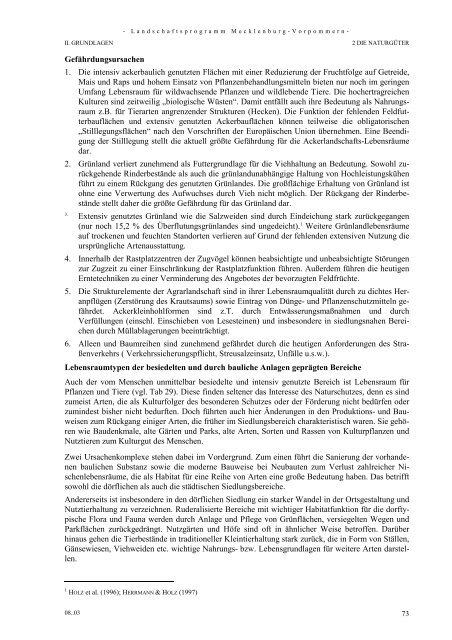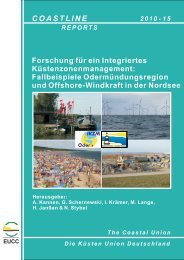Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
II. GRUNDLAGEN<br />
2 DIE NATURGÜTER<br />
Gefährdungsursachen<br />
1. Die intensiv ackerbaulich genutzten Flächen mit einer Reduzierung der Fruchtfolge auf Getreide,<br />
Mais und Raps und hohem Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln bieten nur noch im geringen<br />
Umfang Lebensraum für wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tiere. Die hochertragreichen<br />
Kulturen sind zeitweilig „biologische Wüsten“. Damit entfällt auch ihre Bedeutung als Nahrungsraum<br />
z.B. für Tierarten angrenzender Strukturen (Hecken). Die Funktion der fehlenden Feldfutterbauflächen<br />
und extensiv genutzten Ackerbauflächen können teilweise die obligatorischen<br />
„Stilllegungsflächen“ nach den Vorschriften der Europäischen Union übernehmen. Eine Beendigung<br />
der Stilllegung stellt die aktuell größte Gefährdung für die Ackerlandschafts-Lebensräume<br />
dar.<br />
2. Grünland verliert zunehmend als Futtergrundlage für die Viehhaltung an Bedeutung. Sowohl zurückgehende<br />
Rinderbestände als auch die grünlandunabhängige Haltung von Hochleistungskühen<br />
führt zu einem Rückgang des genutzten Grünlandes. Die großflächige Erhaltung von Grünland ist<br />
ohne eine Verwertung des Aufwuchses durch Vieh nicht möglich. Der Rückgang der Rinderbestände<br />
stellt daher die größte Gefährdung für das Grünland dar.<br />
3.<br />
Extensiv genutztes Grünland wie die Salzweiden sind durch Eindeichung stark zurückgegangen<br />
(nur noch 15,2 % des Überflutungsgrünlandes sind ungedeicht). 1 Weitere Grünlandlebensräume<br />
auf trockenen und feuchten Standorten verlieren auf Grund der fehlenden extensiven Nutzung die<br />
ursprüngliche Artenausstattung.<br />
4. Innerhalb der Rastplatzzentren der Zugvögel können beabsichtigte und unbeabsichtigte Störungen<br />
zur Zugzeit zu einer Einschränkung der Rastplatzfunktion führen. Außerdem führen die heutigen<br />
Erntetechniken zu einer Verminderung des Angebotes der bevorzugten Feldfrüchte.<br />
5. Die Strukturelemente der Agrarlandschaft sind in ihrer Lebensraumqualität durch zu dichtes Heranpflügen<br />
(Zerstörung des Krautsaums) sowie Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gefährdet.<br />
Ackerkleinhohlformen sind z.T. durch Entwässerungsmaßnahmen und durch<br />
Verfüllungen (einschl. Einschieben von Lesesteinen) und insbesondere in siedlungsnahen Bereichen<br />
durch Müllablagerungen beeinträchtigt.<br />
6. Alleen und Baumreihen sind zunehmend gefährdet durch die heutigen Anforderungen des Straßenverkehrs<br />
( Verkehrssicherungspflicht, Streusalzeinsatz, Unfälle u.s.w.).<br />
Lebensraumtypen der besiedelten und durch bauliche Anlagen geprägten Bereiche<br />
Auch der vom Menschen unmittelbar besiedelte und intensiv genutzte Bereich ist Lebensraum für<br />
Pflanzen und Tiere (vgl. Tab 29). Diese finden seltener das Interesse des Naturschutzes, denn es sind<br />
zumeist Arten, die als Kulturfolger des besonderen Schutzes oder der Förderung nicht bedürfen oder<br />
zumindest bisher nicht bedurften. Doch führten auch hier Änderungen in den Produktions- und Bauweisen<br />
zum Rückgang einiger Arten, die früher im Siedlungsbereich charakteristisch waren. Sie gehören<br />
wie Baudenkmale, alte Gärten und Parks, alte Arten, Sorten und Rassen von Kulturpflanzen und<br />
Nutztieren zum Kulturgut des Menschen.<br />
Zwei Ursachenkomplexe stehen dabei im Vordergrund. Zum einen führt die Sanierung der vorhandenen<br />
baulichen Substanz sowie die moderne Bauweise bei Neubauten zum Verlust zahlreicher Nischenlebensräume,<br />
die als Habitat für eine Reihe von Arten eine große Bedeutung haben. Das betrifft<br />
sowohl die dörflichen als auch die städtischen Siedlungsbereiche.<br />
Andererseits ist insbesondere in den dörflichen Siedlung ein starker Wandel in der Ortsgestaltung und<br />
Nutztierhaltung zu verzeichnen. Ruderalisierte Bereiche mit wichtiger Habitatfunktion für die dorftypische<br />
Flora und Fauna werden durch Anlage und Pflege von Grünflächen, versiegelten Wegen und<br />
Parkflächen zurückgedrängt. Nutzgärten und Höfe sind oft in ähnlicher Weise betroffen. Darüber<br />
hinaus gehen die Tierbestände in traditioneller Kleintierhaltung stark zurück, die in Form von Ställen,<br />
Gänsewiesen, Viehweiden etc. wichtige Nahrungs- bzw. Lebensgrundlagen für weitere Arten darstellen.<br />
1 HOLZ et al. (1996); HERRMANN & HOLZ (1997)<br />
08..03 73