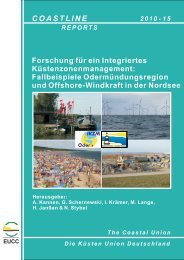Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
II. GRUNDLAGEN<br />
2 DIE NATURGÜTER<br />
Abb.8: Verbreitungsdichte der Heidelerche (Kartierung OAMV) 1<br />
Dauerkulturen. Der kleine Bestand an Dauerkulturen wird überwiegend von Obstbeständen bestimmt.<br />
Dazu kommen noch Baumschulen und Energieholzkulturen, letztere zukünftig möglicherweise<br />
zunehmend, während andere (z.B. Korbweiden) praktisch keine Rolle mehr spielen. Obstbestände<br />
und Baumschulen gehören zu den recht intensiv bearbeiteten Kulturen, sowohl vom Stoff- und Energie-,<br />
als auch vom Arbeitskräfteeinsatz, aus Sicht des Naturschutzes sind diese Flächen weniger interessant.<br />
Wichtiger sind die sog. Streuobstbestände, die es allerdings traditionell nicht im gleichen Umfang wie<br />
in Südwestdeutschland gibt. Doch strukturell ähnliche, wenn auch kleine Flächen mit Obstbaumbeständen<br />
auf Grünland, mitunter aufgelassenem, gibt es vereinzelt. Hier finden u.a. Höhlen- und Halbhöhlenbrüter,<br />
die parkartige, halboffene Nahrungshabitate bevorzugen, geeignete Lebensbedingungen<br />
Strukturelemente der Agrarlandschaft. Die eigentlichen landwirtschaftlichen Nutzflächen, bieten<br />
wie bereits mehrfach erwähnt vielen Tierarten nur einen Teillebensraum, beispielsweise für die Nahrungssuche.<br />
Angrenzende nutzungsfreie Bereiche, wie Kleingewässer und Sölle, Gebüsche, Brachen,<br />
Feldraine, Lesesteinwälle, Feldgehölze und Feldhecken bieten beispielsweise Unterschlupf und Nestbaumöglichkeiten<br />
und können daher ein wesentliches Merkmal für die Lebensraumqualität der Agrarlandschaft<br />
sein.<br />
Heckendichte in <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong><br />
Dichte<br />
gering<br />
hoch<br />
Feldhecken wurden überwiegend in Westmecklenburg<br />
im 18. und 19. Jahrhundert zur Flächenabgrenzung<br />
angelegt und bis in das 20. Jahrhundert hinein<br />
in vielfältiger Weise, insbesondere als Holzreservoir<br />
genutzt. Eine Auswertung der Biotop- und Nutzungstypenkartierung<br />
zeigt, dass die größte Heckendichte<br />
mit 9,7 m/ha 2 in Westmecklenburg zu finden<br />
ist, wo sie noch heute öfter Schlaggrenzen säumen.<br />
In den östlichen Landesteilen waren Heckenzüge vor<br />
allem für Nutzungslücken (Gemarkungs- und Nutzungsgrenzen)<br />
typisch, die aktuelle Heckendichte<br />
liegt zwischen 2,1 und 4,2 m/ha. Feldhecken wurden<br />
in der Vergangenheit zur Vergrößerung der Schläge<br />
vielerorts beseitigt, so dass vor allem in Westmecklenburg<br />
der Feldheckenbestand von 1900 bis 1991 um 66 % reduziert wurde. Spätestens mit ihrer<br />
Sicherung als gesetzlich geschützte Biotope (vgl. Kap. I-1.5) konnte diese Entwicklung gestoppt werden.<br />
Feldhecken weisen als lineare, vorwiegend aus Sträuchern aufgebaute und z.T. von Bäumen durchsetzte<br />
Gehölze in der offenen Landschaft eine Vielfalt von Funktionen für die Agrarlandschaft auf.<br />
Neben positiven Auswirkungen auf Mikroklima und Bodenschutz, ihren landschaftsästhetischen<br />
Funktion und der kulturhistorischen Bedeutung bieten Feldhecken einer Reihe von Pflanzen und vor<br />
1 GIS (2000): Darstellung der Brutverbreitung von Zielarten des Naturschutzes<br />
2 LUNG (2001): Landschaftsökologische Grundlagen zum Schutz, zur Pflege und zur Neuanlage von Feldhecken in M-V.<br />
08..03 71