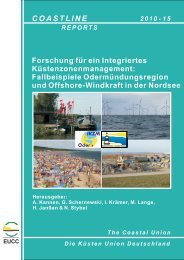Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
III Entwicklungskonzeption<br />
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
3. Maßnahmen<br />
Durch Methoden des integrierten Pflanzenschutzes (standortangepasstes Anbausystem, vielfältige,<br />
mindestens dreigliedrige Fruchtfolge, geeignete Anbautechnik und Kulturart) und Anwendung biologisch-technischer<br />
Maßnahmen (z.B. Nützlingsanwendung) soll der Einsatz von chemischen<br />
Pflanzenbehandlungsmitteln zum Schutz der Gewässer und Böden reduziert werden.<br />
Standortgerechte Landnutzung<br />
Die intensive landwirtschaftliche Produktion soll sich auf Böden mit einer höheren natürlichen<br />
Ertragsfähigkeit konzentrieren (vgl. Karte II, insbesondere Boden-Funktionsbereiche 4,5 und 14) ,<br />
da auf diesen Böden die Umweltauswirkungen einer konventionellen landwirtschaftlichen Produktion<br />
am geringsten sind. Hier sind die Grundlagen für eine leistungsstarke und umweltverträgliche<br />
Landwirtschaft zu sichern, die ressourcenschonende Stoffeinträge ( N-Bilanzüberschuss unter 50<br />
kg/ha/a) und den Erhalt von naturnahen Landschaftsstrukturen (z.B. Sölle) gewährleisten. Dabei<br />
sollen flächendeckend die Methoden des integrierten Landbaus Anwendung finden, da die aktuell<br />
praktizierte konventionelle Landwirtschaft als nicht nachhaltig in allen drei Bereichen beurteilt<br />
wird 1 .<br />
Grenzertragsstandorte sollen bevorzugt (z.B. Moore, Heiden und andere Trocken- und Magerstandorte)<br />
extensiv oder naturschutzgerecht bewirtschaftet werden. Eine standortangepasste Nutzung<br />
dieser Böden schließt die Erhaltung bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Wasser- und<br />
Nährstoffverhältnisse ein (vgl. u.a. Kap. III-3.1.2.1 und –3.1.4.2).<br />
Eine Umwandlung von Moorgrünland in Acker widerspricht der guten fachlichen Praxis. Eine weitere<br />
ackerbauliche Nutzung 2 ist nur noch auf den nicht mehr renaturierbaren flachgründigen Moorflächen<br />
zu verantworten.<br />
Auf Niedermoorflächen mit einer natürlichen Vorflut soll eine moorschonende Grünlandnutzung<br />
unter Verzicht auf den Einsatz von Stickstoffdüngung und Pflanzenschutzmitteln erfolgen.<br />
Auf Moorstandorten, die durch intensive Nutzungsformen in ihrer Bodenstruktur erheblich geschädigt<br />
sind (Vermullung, Sackung), ist die Wiederherstellung eines naturnahen Wasserregimes anzustreben,<br />
um eine fortschreitende Bodenzerstörung zu vermeiden (vgl. Kap. III-3.1.2.1).<br />
Der Bodenerosion ist zum Boden- und Gewässerschutz durch eine standortangepasste Nutzung<br />
entgegenzuwirken (vgl. Kap. III-3.1.4.5). Zu berücksichtigen sind insbesondere die Bodenart und<br />
der Bodenzustand, der Geräteeinsatz, die Hangneigung, die Wasser- und Windverhältnisse, die<br />
Fruchtarten sowie die Bodenbedeckung (vgl. Umweltgutachten 2000). Die Winderosion soll durch<br />
Erhalt bzw. Schaffung geeigneter Strukturelemente (Hecken, Gehölze, Baumreihen) und durch eine<br />
möglichst lange Pflanzenbedeckung der Äcker (z.B. durch Untersaaten, Zwischenfruchtanbau) verringert<br />
werden. Die Erosionsdisposition sollte nicht größer als 8 t/ha/a sein.<br />
Ein Grünlandumbruch auf erosionsgefährdeten Hanglagen steht den Grundsätzen der guten fachlichen<br />
Praxis entgegen.<br />
Erhalt des Strukturreichtums und der Lebensraumfunktion der Landschaft<br />
Die landwirtschaftliche Nutzung hat so zu erfolgen, dass Strukturelemente der Landschaft (z.B.<br />
Kopfweiden und Hecken, Säume, Gräben, Feldgehölze, Sölle) in der Agrarlandschaft vor Beeinträchtigungen<br />
geschützt werden (vgl. Kap. III-3.1.4.4). Der Mindestanteil der Strukturelemente und<br />
naturnahen Biotope in der Agrarlandschaft nach § 5 Abs. 3 BNatSchG sollte mindestens 5 bis 10 %<br />
betragen zuzüglich eines Anteils von mindestens 10 % an Dauergrünland und Brachen, um die biologische<br />
Vielfalt dauerhaft sicherstellen zu können 3 . Eine regionalisierte Mindestdichte ist zu entwickeln,<br />
um den verschiedenen Landschaftsräumen gerecht zu werden, die zum Teil auch „offen“<br />
1 Wissenschaftlicher Beirat des UM M-V 2001<br />
2 Derzeit werden noch etwa 7 % der Moorflächen des Landes als Acker genutzt (Stand 1998, LANDESREGIERUNG M-V 2000)<br />
3 Vgl. UMWELT (2000) S.62; VOIGTLÄNDDER, U., et. al. (2001): Ermittlung von Ursachen für die Unterschiede im biologischen<br />
Inventar der Agrarlandschaft in Ost- und Westdeutschland.<br />
240 08.03