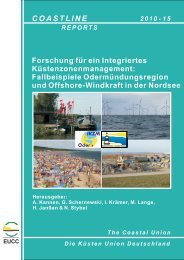Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
III Entwicklungskonzeption<br />
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
3. Maßnahmen<br />
Ein Abbau von Torf soll aufgrund der besonders negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt<br />
zukünftig nur noch in geringem Umfang für medizinische Zwecke erfolgen. Die Nutzung gegenwärtig<br />
noch bestehender Abbaugebiete soll nach Ablauf der Bewilligung eingestellt werden. Für<br />
alle Torfnutzungen sollte geprüft werden, ob Substitute zur Verfügung stehen.<br />
Bestehende Abbaugenehmigungen können die Versorgung mit Rohstoffen in <strong>Mecklenburg</strong>-<br />
<strong>Vorpommern</strong> bereits für einen längeren Zeitraum sichern. Der Abbau auf den bereits zugelassenen<br />
Flächen soll zeitlich vorrangig erfolgen und eine fortlaufende Rekultivierung vorsehen. Dadurch<br />
können die Eingriffe kurz- bis mittelfristig ausgeglichen werden. Großflächige Rohstoffvorkommen<br />
sind in räumliche und zeitliche Abbauabschnitte zu gliedern, um die Beeinträchtigungen von<br />
Natur und Umwelt zu minimieren. Die einzelnen Abschnitte sind unmittelbar nach Beendigung des<br />
Abbaus zu renaturieren bzw. zu rekultivieren.<br />
Weitere Abbaugenehmigungen sollen kurz- bis mittelfristig nur außerhalb von „Bereichen herausragender<br />
Bedeutung“ nach Karte VII und innerhalb der „Vorranggebiete Rohstoffsicherung“ der<br />
Regionalen Raumordnungsprogramme erfolgen, welche auf den Vorschlägen der Landschaftsrahmenplanung<br />
beruhen. Vor Erteilung von Abbaugenehmigungen in „Vorsorgegebieten Rohstoffsicherung“<br />
sollte angestrebt werden, die Vorräte in den „Vorranggebieten“ auszuschöpfen.<br />
Vor Beginn des Abbaus sollte ein Folgefunktionskonzept vorliegen. Die darin dargestellten Renaturierungsziele<br />
sind aus dem jeweiligen naturräumlichen Standortpotenzial, unter Berücksichtigung<br />
der Veränderung der Standortbedingungen durch den Abbau und unter Beachtung aller auf<br />
das Gebiet einwirkenden Randeinflüsse zu bestimmen. Dabei sind neben Rekultivierungsmaßnahmen<br />
auch Renaturierungsmaßnahmen vorzusehen. Insbesondere sollten auch offene trockene sowie<br />
nasse Bereiche der natürlichen Sukzession überlassen und dinglich gesichert werden.<br />
Bereits aufgeschlossene Tagebaue sind möglichst vollständig zu abzubauen. Der Erweiterung vorhandener<br />
Abbauflächen ist in der Regel gegenüber der Erschließung neuer Standorte der Vorzug<br />
zu gewähren. Bodenschätze in Tagebaurestlöchern sind gegenüber Neuaufschlüssen vorrangig abzubauen.<br />
In Bereichen mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit des Arten- und Lebensraumpotenzials<br />
(vgl. Kap. II-2.1, Karte I), des Landschaftsbildes (vgl. Kap. II-2.5, Karte IV), des Bodenpotenzials<br />
(vgl. Kap. II-2.2, Karte II) und Bereichen mit „besonderer Bedeutung“ (vgl. Karte VII) ist ein Abbau<br />
von Rohstoffen zu vermeiden, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung der genannten Potenziale<br />
zu erwarten ist.<br />
Rohstoffgewinnung im marinen Bereich<br />
Die Gewinnung mariner Sedimente kann unmittelbar oder aufgrund indirekter Folgewirkungen erhebliche<br />
Auswirkungen auf das marine Ökosystem haben.<br />
Beim Abbau von Sedimentlagerstätten in der Ostsee sollen die Auswirkungen auf das marine Ökosystem<br />
so gering wie möglich gehalten werden (vgl. §49 BBergG, §34 (1) FlsBergV). Daraus ergeben<br />
sich folgende Anforderungen:<br />
Besonders empfindliche Gebiete („Bereiche ungestörter Naturentwicklung“ nach Karte V) sollen<br />
von der Rohstoffgewinnung ausgeschlossen werden (vgl. Kap. III-3.1.1.1, mit Ausnahme für Zwecke<br />
des Küstenschutzes).<br />
Um die Entstehung von Trübstofffahnen zu minimieren, soll ein Abbau so trocken wie möglich<br />
erfolgen. Technische Optimierungen an den Baggereinrichtungen sowie die Optimierung der Arbeitsgeschwindigkeit<br />
können zur Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt beitragen.<br />
Beim Abbau von Sedimenten mit einem hohen Anteil an Feinbestandteilen lassen sich die<br />
Umweltauswirkungen durch den Einsatz von Spezialausrüstungen (z.B. Schlickvorhänge) reduzieren.<br />
Die Wiederbesiedlung der Abbaufläche soll durch geeignete Vorsorgemaßnahmen erleichtert werden.<br />
Es ist z.B. sicherzustellen, dass nach der Entnahme das verbleibende Sediment am Meeresboden<br />
mit einer angemessenen Mächtigkeit den Eigenschaften des ursprünglichen Sediments<br />
256 08.03