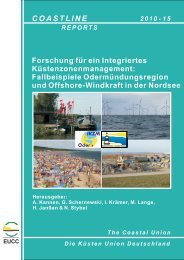Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong>-<br />
II. GRUNDLAGEN<br />
2 DIE NATURGÜTER<br />
In den größeren Stromauen kommen häufiger Vermengungen mit anderen Moortypen vor, besonders<br />
mit Verlandungsmoor (Flutrinnen, Altwässer). Vom typischen Auenüberflutungsmoor abweichend<br />
sind die relativ großflächigen Überflutungsbereiche der Flusstalmoore relativ arm an unlöslichen<br />
Mineralstoffen, weil gerade in den durch Rückstau von der Ostsee häufiger überfluteten unteren Talmoorabschnitten<br />
Fließgeschwindigkeiten und deshalb Materialtransport gering sind.<br />
Flusstal- und Beckenmoore. Flusstalmoore haben sich insbesondere in den eiszeitlichen Schmelzwasserabflussbahnen<br />
des Vorpommerschen Flachlandes (ebene Grundmoräne) unter dem Einfluss des<br />
Rückstaus des Ostseespiegels seit der Litorinazeit entwickelt. Sie sind<br />
Verbreitungsschwerpunkte<br />
Flusstalmoore nach<br />
Landschaftszonen<br />
Dichte<br />
gering hoch<br />
komplexe Lebensräume, in denen verschiedene Moortypen vereint<br />
sind. Regelmäßig kommen Quellmoor (Hänge am Talrand, sofern<br />
Wasser zutage tritt), Durchströmungsmoor (Zone zwischen dem Talrand<br />
und dem Überflutungsmoor) sowie Überflutungsmoor (flussnahe,<br />
durch regelmäßige Überschwemmungen ernährte Moorbereiche) vor.<br />
Das Durchströmungsmoor bestimmt dabei am stärksten den Charakter<br />
funktionsfähiger Flusstalmoore und dieses entwickelt wiederum in den<br />
Flusstalmooren seine spezifische Ausprägung. Durchströmungsmoor<br />
kann auch unter anderen Bedingungen der Moorbildung auftreten, etwa in den sogenannten Beckenmooren,<br />
wenn eine vorherrschende Richtung des Grundwasserstromes die Moorbildung bestimmt, der<br />
Strom aber durch das aufwachsende Moor selbst oder auch durch besondere Geländeformen gehemmt<br />
ist (z.B. Friedländer Große Wiese).<br />
Das Durchströmungsmoor verdankt seine Entstehung dem Grundwasserstrom, der aus den Sanden<br />
zwischen den kalkhaltigen Geschiebemergelschichten tritt und zum geringfügig niedriger liegenden<br />
Fluss strebt. Im Land nehmen Durchströmungsmoore ca. 37 % der gesamten Moorfläche ein; der<br />
größte Teil davon liegt in Flusstalmooren. Der Moortyp hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im Vorpommerschen<br />
Flachland, wo er mit 57 % vertreten ist und den Hauptbestandteil der Flusstalmoore<br />
bildet. Ein Teil dieser Moore reicht in das Küstengebiet hinein. Häufig sind Durchströmungsmoore<br />
auch im Rückland der Seenplatte, außer im Elbetal kommen sie auch in den übrigen Landesteilen vor.<br />
Die Vegetationsstruktur der Flusstalmoore ist außerordentlich vielgestaltig. An den Talhängen tritt<br />
Wasser zutage, Brunnenkresse, Stumpfblütige Binse, Trollblume oder Erlenbruchwald zeigen den<br />
Wasserüberschuss und relativ mineralreiches Wasser an. Das Durchströmungsmoor wird natürlicherweise<br />
durch Braunmoos-Seggenriede charakterisiert, doch gibt es bereits bei schwacher Entwässerung<br />
eine Tendenz zur Ansiedlung von Gehölzen; in ärmeren Bereichen entwickeln sich Birkenbruchgesellschaften<br />
(z.B. Faulbaum-Birkenbruch), bei mäßiger Nährstofffreisetzung dominieren Grauweidengebüsche<br />
mit eingestreuten Lorbeerweiden, dazwischen wachsen überwiegend Großseggenriede. Ist<br />
der Kalkgehalt ausreichend, verzögert sich die Bewaldung und Arten wie Rostrotes Kopfried, Sumpf-<br />
Tarant, Mehlprimel und Strauchbirke können dem Konkurrenzdruck widerstehen. Auch länger beständige<br />
Vorwaldstadien mit Kriechweide und schwachwüchsigen Moorbirken sind zu finden – außerdem<br />
ausgedehnte Seggenriede, in denen, abhängig von der Nährstoffversorgung, Sumpfblutauge<br />
oder Mädesüß auffallen. Bei geringer Entwässerung und Mahd können sich Pfeifengraswiesen, bei<br />
mäßiger Entwässerung und Düngung Kohldistel-Feuchtwiesen mit Schlangenknöterich, Trollblume,<br />
Bitterem Kreuzblümchen und Kleinem Baldrian entwickeln. Das Überflutungsmoor ist vor allem an<br />
einem zunehmenden Schilfanteil zu erkennen. In den oberen, nährstoffärmeren Bereichen sind die oft<br />
schütteren Röhrichte mit Seggen durchsetzt oder es kommen noch lichtbedürftige Arten wie Fieberklee<br />
vor. In Flussnähe wird das starke Schilf von Nährstoffzeigern wie Bittersüßer Nachtschatten oder<br />
Engelwurz begleitet.<br />
Flusstal- und Beckenmoore haben aus verschiedenen Gründen eine herausragende Bedeutung für den<br />
Naturschutz. Im Nordosten des Landes sind sie der flächenmäßig dominierende Moortyp. Im Grenztal<br />
und in <strong>Vorpommern</strong>, wo Einflüsse des Rückstaus der Ostsee weit binnenwärts reichen, ist ein relativ<br />
hoher Anteil dieser Moore noch in unterschiedlichem Grade funktionsfähig. In den weit nach <strong>Mecklenburg</strong><br />
hineinreichenden Gletscherzungenbecken sind die Flusstalmoore bis auf kleinste Reste stark<br />
gestört oder beseitigt. Die Größe und weite Erstreckung der Talmoore durch die Grundmoränengebie-<br />
52<br />
08.03