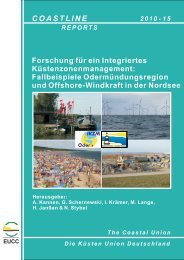Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- <strong>Landschaftsprogramm</strong> <strong>Mecklenburg</strong>- <strong>Vorpommern</strong>-<br />
II.GRUNDLAGEN<br />
2 DIE NATURGÜTER<br />
Die wichtigsten anthropogenen Einflüsse auf die Böden gibt Tab. 29 wieder, wobei die Wirkungen<br />
der Moordegradierung nach Intensität und Umfang die größten ungünstigen Wirkungen auf den Naturhaushalt<br />
zur Folge haben. Der Verlust an flachgründigen Moorböden durch vollständige Torfzehrung<br />
in den letzten 30 Jahren wird zum Beispiel auf mindestens 29.000 ha geschätzt 1 ., über 2/3 der<br />
Moore sind stark bis extrem entwässert und der Torf ist vererdet und vermulmt.<br />
Aufgrund der Bodenart und Hangneigung sind große Ackerflächen durch Bodenverdichtung und -<br />
erosion durch Wasser und Wind gefährdet (genauere Angaben in Kap. II-2.7). Durch die intensive<br />
Landwirtschaft ist eine deutliche Belastung des Bodens mit Nährstoffen nachweisbar, welche die<br />
Wasserbeschaffenheit des oberflächennahen Grundwassers und der Gewässer wesentlich beeinflusst.<br />
Durch Wasser- und Winderosion werden in die Flussgebiete jährlich ca. 422 t Stickstoff und 393 t<br />
Phosphor eingetragen 2 (vgl. auch Aussagen in Kap. II-2.3 zu Stoffeinträgen in Fließgewässer).<br />
Bewertung von Böden<br />
Seit 1995 liegt eine Übersichtserfassung zur Bodenverbreitung im Landschaftsinformationssystem<br />
<strong>Mecklenburg</strong>-<strong>Vorpommern</strong> (LINFOS) im Maßstab 1:50.000 vor 3 , die im Maßstab 1:250.000 generalisiert<br />
und als Karte II im Kartenanhang beigefügt ist.<br />
Für die planerische Anwendung wurden „Boden-Funktionsbereiche“ gebildet, die zum Teil die später<br />
mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz 1998 definierten natürlichen Bodenfunktionen berücksichtigen.<br />
Die 19 Funktionsbereiche beruhen auf folgenden Merkmalen:<br />
• Ausgangssubstrat<br />
• Nährstoffversorgung<br />
• Bodengruppe in Hinblick auf die bautechnische Eignung (nach DIN 18196)<br />
• Speicher und Reglerfunktionen (Puffervermögen, Filterleistung)<br />
• ökologischer Feuchtegrad (nach: Bodenkundlicher Kartieranleitung, AG BODENKUNDE )<br />
• Gefahr der Anreicherung von Schadstoffen<br />
• ökologisches Standortpotenzial mit besonderer Lebensraumfunktion (geringer Nährstoff- und<br />
Wassergehalt, hoher Kalkgehalt, hoher Salzgehalt).<br />
Landesweit wurden mit Hilfe von Einzelparametern das natürliche Ertragspotenzial und die Speicherund<br />
Reglerfunktion bewertet. Außerdem sind verschiedene morphogenetische Besonderheiten (Dünen,<br />
Endmoränen, Talranderosionsgebiete, Oser u.a.) im Hinblick auf deren landeskundliches Potenzial<br />
(Archivfunktion) dargestellt.<br />
Vor allem die Lehmböden der Funktionsbereiche 4 bis 7 mit hohem natürlichen Ertragspotenzial sind<br />
sehr gut für eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung geeignet. Die Sandböden der Funktionsbereiche<br />
1 bis 3 (Ackerzahl < 33) sind dagegen weniger gut für ackerbauliche Nutzungen geeignet, hier<br />
besteht auch im besonderen Maß die Gefahr von Stoffeinträgen in das Grundwasser. Völlig ungeeignet<br />
für den Ackerbau sind die Moorböden der Funktionsbereiche 10 bis 12.<br />
Abschließend wird eine Gesamtbewertung der Schutzwürdigkeit des Bodenpotenzials mit Hilfe einer<br />
vierstufigen Skala anhand des natürlichen Ertragspotenzials, des Speicher- und Reglerpotenzials sowie<br />
des landeskundlichen Potenzials (besondere morphogenetische Strukturen) und des Kriteriums<br />
„extreme Standortbedingungen“ (Biotopentwicklungspotenzial) vorgenommen 4 .<br />
Nach dieser Bewertung haben vor allem die Moorfunktionsbereiche sowie die Bereiche mit besonderen<br />
Strukturen (Dünen, Talranderosionsgebiete) und extremen Standortbedingungen (stark kalkhaltige<br />
Böden, salzbeeinflusste Böden) eine sehr hohe Schutzwürdigkeit.<br />
1 LAUN (1997a): Landschaftsökologische Grundlagen und Ziele zum Moorschutz in M-V. Materialien (3).<br />
2 DEUMLICH, D. & M. FRIELINGHAUS (1994): Eintragspfade Bodenerosion und Oberflächenabfluss im Lockergesteinsbereich.<br />
agrarspectrum, Bonn, H. 22.<br />
3 Grundlage sind die Daten des Bodenpotenzials der LABL (1995)<br />
4 genaue Erläuterungen in LABL (1995)<br />
78 08.03