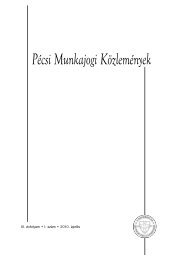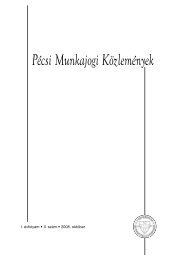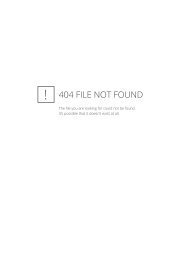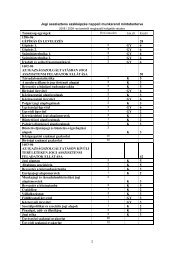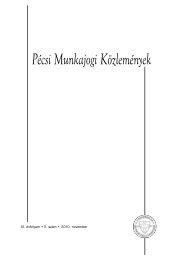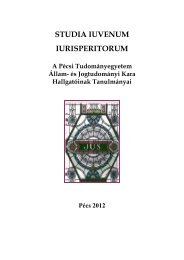2004. évi 2. szám - Jura - Pécsi Tudományegyetem
2004. évi 2. szám - Jura - Pécsi Tudományegyetem
2004. évi 2. szám - Jura - Pécsi Tudományegyetem
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Heinrich Scholler: Der gleiche Zugang zu den Gerichten<br />
115<br />
„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der<br />
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und<br />
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin,„<br />
hinzugefügt worden.<br />
<strong>2.</strong> Die Waffengleichheit<br />
Auch ein weiterer Gesichtspunkt hat den Gleichheitssatz<br />
ausgedehnt auf die faktische Gleichheit.<br />
Aus den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen<br />
und den arbeitsgerichtlichen Verfahren entwickelte<br />
sich das Postulat der „Waffengleichheit„. Es besagt,<br />
dass die Sozialpartner insbesondere Arbeitgeber<br />
und Arbeit nehmervereinigungen im Arbeitskampf<br />
außerhalb des Gerichtes wie in der gerichtlichen<br />
und Arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung mit<br />
gleich starken Waffen kämpfen sollen. Ihnen soll<br />
die Möglichkeit vom Recht eingeräumt werden, mit<br />
gleichen gerichtlichen rechtlichen und politischen<br />
Waffen zu kämpfen. Damit wurde auch die Gleichheit<br />
des Zugangs zu den Gerichten besonders hervorgehoben.<br />
In Deutschland gibt es darüber hinaus<br />
für arbeitsrechtliche Streitigkeiten eine besondere<br />
arbeitsgerichtliche Gerichtsbarkeit, die über drei<br />
Instanzen – Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht<br />
und Bundesarbeitsgericht – organisiert ist. Schon<br />
die Herausnahme der Arbeitsgerichtsbarkeit aus<br />
der ordentlichen und Zivilgerichtsbarkeit war eine<br />
Betonung der Waffengleichheit und der Versuch,<br />
gleichen Zugang zu den Gerichten den Sozialpartnern,<br />
den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern zu<br />
garantieren.<br />
In der Gestalt der Waffengleichheit tritt uns die<br />
Chancengleichheit ausschließlich in ihrem funktionalen<br />
Teilinhalt entgegen. Denn die Waffen, deren<br />
Anwendung chancengleich zugesichert wird, sind<br />
nicht Bedingungen, Interessen oder Reflexe, sondern<br />
ausgeprägte abgegrenzte Rechte. Gerade das Prozessrecht<br />
ist der Sitz dieser funktional verstandenen<br />
Chancengleichheit, wie am Beispiel der Rechtsmitteleinlegung<br />
dargetan werden soll. Der Prozessgang<br />
als Umformung des Waffenganges hat die Idee<br />
der Waffen- und Chancengleichheit am klarsten<br />
beibehalten. Zudem steht die prozessuale Chancengleichheit<br />
unter dem Gesetz der kleinen Zahl, da vor<br />
dem neutralen Richter nur zwei Gruppen handelnd<br />
auftreten. Dennoch finden wir auch im geltenden<br />
Prozessrecht unvollkommene Einrichtungen, die den<br />
Gedanken der Prozessgleichheit oder prozessualen<br />
Chancengleichheit nicht voll verwirklichen. 1<br />
Prof. Dr. Jur. Dr. Jur. H. C. Heinrich Scholler<br />
München<br />
Der gleiche Zugang<br />
zu den Gerichten<br />
I. Die Weiterentwicklung<br />
des Gleichheitssatzes vom<br />
Willkürverbot zu einem Gebot<br />
der Chancengleichheit<br />
1. Die Wandlungen des Gleichheitssatzes<br />
Vom formalen Standpunkt aus konnte man sagen,<br />
dass auch die arme Partei das Recht auf Zugang<br />
zu den Gerichten in gleicher Weise hat wie die<br />
vermögende. Niemand hindert die arme Partei,<br />
den Weg zu den Gerichten zu beschreiten, wenn<br />
sie sich auf irgendeine Weise Geld verschaffen<br />
kann, sei es durch ein Darlehen oder sei es durch<br />
irgend eine öffentliche Spendenaktion. Man spricht<br />
daher auch vom Inhalt des Gleichheitssatzes als<br />
dem Gebot der Rechtsgleichheit. Dieses Gebot der<br />
Rechtsgleichheit besagte nur, dass arm und reich<br />
gleiche Rechte haben und dass die Unfähigkeit<br />
der armen Partei, Gerichts- und Anwaltskosten zu<br />
bezahlen, nur eine Ungleichheit tatsächlicher Art sei.<br />
Die Rechtsgleichheit würde aber niemals verlangen,<br />
dass auch gleiche Tatsachen geschaffen würden.<br />
Dennoch entwickelte sich die Forderung nach einer<br />
égalité en fait, also nach der Gleichheit der sozialen<br />
Tatsachen besonders im Hinblick auf die ungleichen<br />
Vermögensverhältnisse innerhalb der Gesellschaft.<br />
Wenn das Grundgesetz in Art. 6 Abs. 5 davon spricht,<br />
dass die Bedingungen der nicht ehelichen Kinder<br />
denen der ehelichen gleichgestellt werden müssen,<br />
so wird hier nicht nur eine Gleichheit der Rechte,<br />
sondern wohl darüber hinaus auch eine Gleichheit<br />
der tatsächlichen Verhältnisse gefordert. Dies ergibt<br />
sich aus dem Wort: „Gleichheit der Bedingungen„.<br />
Diese gleiche Wendung zur Tatsachengleichheit hat<br />
sich auch auf dem Gebiet der Gleichheit von Mann<br />
und Frau vollzogen. Der Grundsatz der Gleichheit<br />
der Geschlechter war ursprünglich in Art. 3 Abs. 2<br />
GG nur als Rechtsgleichheit enthalten. Durch eine<br />
Novellierung der Verfassung ist aber nunmehr<br />
auch die tatsächliche Gleichheit mit den Worten<br />
JURA 2004/<strong>2.</strong>