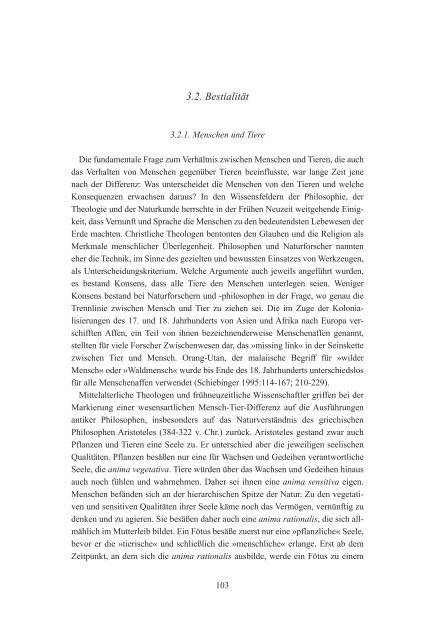Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.2. Bestialität<br />
3.2.1. Menschen und Tiere<br />
Die fundamentale Frage zum Verhältnis zwischen Menschen und Tieren, <strong>die</strong> auch<br />
das Verhalten von Menschen gegenüber Tieren beeinflusste, war lange Zeit jene<br />
nach der Differenz: Was unterscheidet <strong>die</strong> Menschen von den Tieren und welche<br />
Konsequenzen erwachsen daraus? In den Wissensfeldern der Philosophie, der<br />
Theologie und der <strong>Natur</strong>kunde herrschte in der Frühen Neuzeit weitgehende Einigkeit,<br />
dass Vernunft und Sprache <strong>die</strong> Menschen zu den bedeutendsten Lebewesen der<br />
Erde machten. Christliche Theologen bentonten den Glauben und <strong>die</strong> Religion als<br />
Merkmale menschlicher Überlegenheit. Philosophen und <strong>Natur</strong>forscher nannten<br />
eher <strong>die</strong> Technik, im Sinne des gezielten und bewussten Einsatzes von Werkzeugen,<br />
als Unterscheidungskriterium. Welche Argumente auch jeweils angeführt wurden,<br />
es bestand Konsens, dass alle Tiere den Menschen unterlegen seien. Weniger<br />
Konsens bestand bei <strong>Natur</strong>forschern und -philosophen in der Frage, wo genau <strong>die</strong><br />
Trennlinie zwischen Mensch und Tier zu ziehen sei. Die im Zuge der Kolonialisierungen<br />
des 17. und 18. Jahrhunderts von Asien und Afrika nach Europa verschifften<br />
Affen, ein Teil von ihnen bezeichnenderweise Menschenaffen genannt,<br />
stellten für viele Forscher Zwischenwesen dar, das »missing link« in der Seinskette<br />
zwischen Tier und Mensch. Orang-Utan, der malaiische Begriff für »wilder<br />
Mensch« oder »Waldmensch« wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts unterschiedslos<br />
für alle Menschenaffen verwendet (Schiebinger 1995:114-167; 210-229).<br />
Mittelalterliche Theologen und frühneuzeitliche Wissenschaftler griffen bei der<br />
Markierung einer wesensartlichen Mensch-Tier-Differenz auf <strong>die</strong> Ausführungen<br />
antiker Philosophen, insbesonders auf das <strong>Natur</strong>verständnis des griechischen<br />
Philosophen Aristoteles (384-322 v. Chr.) zurück. Aristoteles gestand zwar auch<br />
Pflanzen und Tieren eine Seele zu. Er unterschied aber <strong>die</strong> jeweiligen seelischen<br />
Qualitäten. Pflanzen besäßen nur eine für Wachsen und Gedeihen verantwortliche<br />
Seele, <strong>die</strong> anima vegetativa. Tiere würden über das Wachsen und Gedeihen hinaus<br />
auch noch fühlen und wahrnehmen. Daher sei ihnen eine anima sensitiva eigen.<br />
Menschen befänden sich an der hierarchischen Spitze der <strong>Natur</strong>. Zu den vegetativen<br />
und sensitiven Qualitäten ihrer Seele käme noch das Vermögen, vernünftig zu<br />
denken und zu agieren. Sie besäßen daher auch eine anima rationalis, <strong>die</strong> sich allmählich<br />
im Mutterleib bildet. Ein Fötus besäße zuerst nur eine »pflanzliche« Seele,<br />
bevor er <strong>die</strong> »tierische« und schließlich <strong>die</strong> »menschliche« erlange. Erst ab dem<br />
Zeitpunkt, an dem sich <strong>die</strong> anima rationalis ausbilde, werde ein Fötus zu einem<br />
103