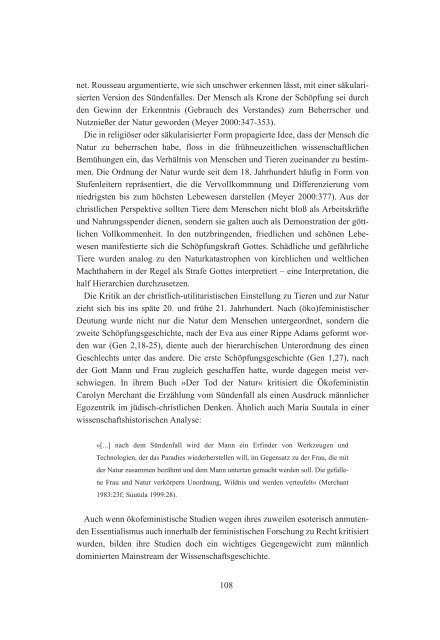Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
net. Rousseau argumentierte, wie sich unschwer erkennen lässt, mit einer säkularisierten<br />
Version des Sündenfalles. Der Mensch als Krone der Schöpfung sei durch<br />
den Gewinn der Erkenntnis (Gebrauch des Verstandes) zum Beherrscher und<br />
Nutznießer der <strong>Natur</strong> geworden (Meyer 2000:347-353).<br />
Die in religiöser oder säkularisierter Form propagierte Idee, dass der Mensch <strong>die</strong><br />
<strong>Natur</strong> zu beherrschen habe, floss in <strong>die</strong> frühneuzeitlichen wissenschaftlichen<br />
Bemühungen ein, das Verhältnis von Menschen und Tieren zueinander zu bestimmen.<br />
Die Ordnung der <strong>Natur</strong> wurde seit dem 18. Jahrhundert häufig in Form von<br />
Stufenleitern repräsentiert, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Vervollkommnung und Differenzierung vom<br />
niedrigsten bis zum höchsten Lebewesen darstellen (Meyer 2000:377). Aus der<br />
christlichen Perspektive sollten Tiere dem Menschen nicht bloß als Arbeitskräfte<br />
und Nahrungsspender <strong>die</strong>nen, sondern sie galten auch als Demonstration der göttlichen<br />
Vollkommenheit. In den nutzbringenden, friedlichen und schönen Lebewesen<br />
manifestierte sich <strong>die</strong> Schöpfungskraft Gottes. Schädliche und gefährliche<br />
Tiere wurden analog zu den <strong>Natur</strong>katastrophen von kirchlichen und weltlichen<br />
Machthabern in der Regel als Strafe Gottes interpretiert – eine Interpretation, <strong>die</strong><br />
half Hierarchien durchzusetzen.<br />
Die Kritik an der christlich-utilitaristischen Einstellung zu Tieren und zur <strong>Natur</strong><br />
zieht sich bis ins späte 20. und frühe 21. Jahrhundert. Nach (öko)feministischer<br />
Deutung wurde nicht nur <strong>die</strong> <strong>Natur</strong> dem Menschen untergeordnet, sondern <strong>die</strong><br />
zweite Schöpfungsgeschichte, nach der Eva aus einer Rippe Adams geformt worden<br />
war (Gen 2,18-25), <strong>die</strong>nte auch der hierarchischen Unterordnung des einen<br />
Geschlechts unter das andere. Die erste Schöpfungsgeschichte (Gen 1,27), nach<br />
der Gott Mann und Frau zugleich geschaffen hatte, wurde dagegen meist verschwiegen.<br />
In ihrem Buch »Der Tod der <strong>Natur</strong>« kritisiert <strong>die</strong> Ökofeministin<br />
Carolyn Merchant <strong>die</strong> Erzählung vom Sündenfall als einen Ausdruck männlicher<br />
Egozentrik im jüdisch-christlichen Denken. Ähnlich auch Maria Suutala in einer<br />
wissenschaftshistorischen Analyse:<br />
»[...] nach dem Sündenfall wird der Mann ein Erfinder von Werkzeugen und<br />
Technologien, der das Para<strong>die</strong>s wiederherstellen will, im Gegensatz zu der Frau, <strong>die</strong> mit<br />
der <strong>Natur</strong> zusammen bezähmt und dem Mann untertan gemacht werden soll. Die gefallene<br />
Frau und <strong>Natur</strong> verkörpern Unordnung, Wildnis und werden verteufelt« (Merchant<br />
1983:23f; Suutula 1999:28).<br />
Auch wenn ökofeministische Stu<strong>die</strong>n wegen ihres zuweilen esoterisch anmutenden<br />
Essentialismus auch innerhalb der feministischen Forschung zu Recht kritisiert<br />
wurden, bilden ihre Stu<strong>die</strong>n doch ein wichtiges Gegengewicht zum männlich<br />
dominierten Mainstream der Wissenschaftsgeschichte.<br />
108