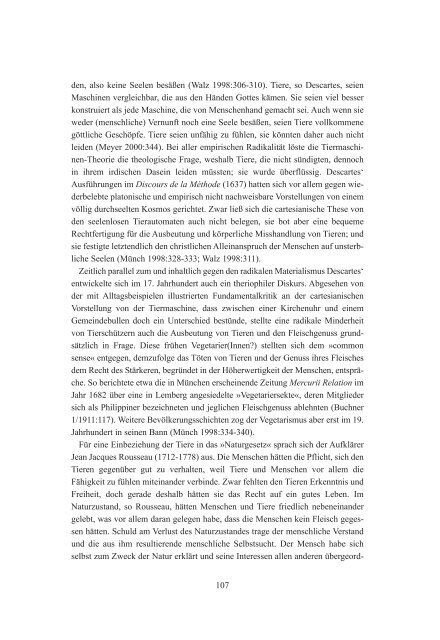Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
den, also keine Seelen besäßen (Walz 1998:306-310). Tiere, so Descartes, seien<br />
Maschinen vergleichbar, <strong>die</strong> aus den Händen Gottes kämen. Sie seien viel besser<br />
konstruiert als jede Maschine, <strong>die</strong> von Menschenhand gemacht sei. Auch wenn sie<br />
weder (menschliche) Vernunft noch eine Seele besäßen, seien Tiere vollkommene<br />
göttliche Geschöpfe. Tiere seien unfähig zu fühlen, sie könnten daher auch nicht<br />
leiden (Meyer 2000:344). Bei aller empirischen Radikalität löste <strong>die</strong> Tiermaschinen-Theorie<br />
<strong>die</strong> theologische Frage, weshalb Tiere, <strong>die</strong> nicht sündigten, dennoch<br />
in ihrem irdischen Dasein leiden müssten; sie wurde überflüssig. Descartes‘<br />
Ausführungen im Discours de la Méthode (1637) hatten sich vor allem gegen wiederbelebte<br />
platonische und empirisch nicht nachweisbare Vorstellungen von einem<br />
völlig durchseelten Kosmos gerichtet. Zwar ließ sich <strong>die</strong> cartesianische These von<br />
den seelenlosen Tierautomaten auch nicht belegen, sie bot aber eine bequeme<br />
Rechtfertigung für <strong>die</strong> Ausbeutung und körperliche Misshandlung von Tieren; und<br />
sie festigte letztendlich den christlichen Alleinanspruch der Menschen auf unsterbliche<br />
Seelen (Münch 1998:328-333; Walz 1998:311).<br />
Zeitlich parallel zum und inhaltlich gegen den radikalen Materialismus Descartes‘<br />
entwickelte sich im 17. Jahrhundert auch ein theriophiler Diskurs. Abgesehen von<br />
der mit Alltagsbeispielen illustrierten Fundamentalkritik an der cartesianischen<br />
Vorstellung von der Tiermaschine, dass zwischen einer Kirchenuhr und einem<br />
Gemeindebullen doch ein Unterschied bestünde, stellte eine radikale Minderheit<br />
von Tierschützern auch <strong>die</strong> Ausbeutung von Tieren und den Fleischgenuss grundsätzlich<br />
in Frage. Diese frühen Vegetarier(Innen?) stellten sich dem »common<br />
sense« entgegen, demzufolge das Töten von Tieren und der Genuss ihres Fleisches<br />
dem Recht des Stärkeren, begründet in der Höherwertigkeit der Menschen, entspräche.<br />
So berichtete etwa <strong>die</strong> in München erscheinende Zeitung Mercurii Relation im<br />
Jahr 1682 über eine in Lemberg angesiedelte »Vegetariersekte«, deren Mitglieder<br />
sich als Philippiner bezeichneten und jeglichen Fleischgenuss ablehnten (Buchner<br />
1/1911:117). Weitere Bevölkerungsschichten zog der Vegetarismus aber erst im 19.<br />
Jahrhundert in seinen Bann (Münch 1998:334-340).<br />
Für eine Einbeziehung der Tiere in das »<strong>Natur</strong>gesetz« sprach sich der Aufklärer<br />
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) aus. Die Menschen hätten <strong>die</strong> Pflicht, sich den<br />
Tieren gegenüber gut zu verhalten, weil Tiere und Menschen vor allem <strong>die</strong><br />
Fähigkeit zu fühlen miteinander verbinde. Zwar fehlten den Tieren Erkenntnis und<br />
Freiheit, doch gerade deshalb hätten sie das Recht auf ein gutes Leben. Im<br />
<strong>Natur</strong>zustand, so Rousseau, hätten Menschen und Tiere friedlich nebeneinander<br />
gelebt, was vor allem daran gelegen habe, dass <strong>die</strong> Menschen kein Fleisch gegessen<br />
hätten. Schuld am Verlust des <strong>Natur</strong>zustandes trage der menschliche Verstand<br />
und <strong>die</strong> aus ihm resultierende menschliche Selbstsucht. Der Mensch habe sich<br />
selbst zum Zweck der <strong>Natur</strong> erklärt und seine Interessen allen anderen übergeord-<br />
107