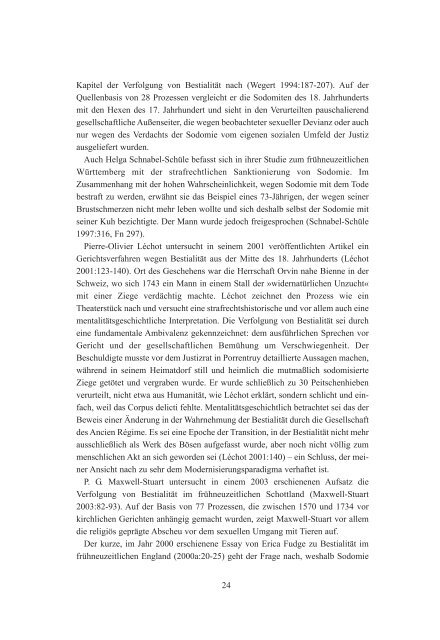Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel der Verfolgung von Bestialität nach (Wegert 1994:187-207). Auf der<br />
Quellenbasis von 28 Prozessen vergleicht er <strong>die</strong> Sodomiten des 18. Jahrhunderts<br />
mit den Hexen des 17. Jahrhundert und sieht in den Verurteilten pauschalierend<br />
gesellschaftliche Außenseiter, <strong>die</strong> wegen beobachteter sexueller Devianz oder auch<br />
nur wegen des Verdachts der Sodomie vom eigenen sozialen Umfeld der Justiz<br />
ausgeliefert wurden.<br />
Auch Helga Schnabel-Schüle befasst sich in ihrer Stu<strong>die</strong> zum frühneuzeitlichen<br />
Württemberg mit der strafrechtlichen Sanktionierung von Sodomie. Im<br />
Zusammenhang mit der hohen Wahrscheinlichkeit, wegen Sodomie mit dem Tode<br />
bestraft zu werden, erwähnt sie das Beispiel eines 73-Jährigen, der wegen seiner<br />
Brustschmerzen nicht mehr leben wollte und sich deshalb selbst der Sodomie mit<br />
seiner Kuh bezichtigte. Der Mann wurde jedoch freigesprochen (Schnabel-Schüle<br />
1997:316, Fn 297).<br />
Pierre-Olivier Léchot untersucht in seinem 2001 veröffentlichten Artikel ein<br />
Gerichtsverfahren wegen Bestialität aus der Mitte des 18. Jahrhunderts (Léchot<br />
2001:123-140). Ort des Geschehens war <strong>die</strong> Herrschaft Orvin nahe Bienne in der<br />
Schweiz, wo sich 1743 ein Mann in einem Stall der »<strong>wider</strong>natürlichen Unzucht«<br />
mit einer Ziege verdächtig machte. Léchot zeichnet den Prozess wie ein<br />
Theaterstück nach und versucht eine strafrechtshistorische und vor allem auch eine<br />
mentalitätsgeschichtliche Interpretation. Die Verfolgung von Bestialität sei durch<br />
eine fundamentale Ambivalenz gekennzeichnet: dem ausführlichen Sprechen vor<br />
Gericht und der gesellschaftlichen Bemühung um Verschwiegenheit. Der<br />
Beschuldigte musste vor dem Justizrat in Porrentruy detaillierte Aussagen machen,<br />
während in seinem Heimatdorf still und heimlich <strong>die</strong> mutmaßlich sodomisierte<br />
Ziege getötet und vergraben wurde. Er wurde schließlich zu 30 Peitschenhieben<br />
verurteilt, nicht etwa aus Humanität, wie Léchot erklärt, sondern schlicht und einfach,<br />
weil das Corpus delicti fehlte. Mentalitätsgeschichtlich betrachtet sei das der<br />
Beweis einer Änderung in der Wahrnehmung der Bestialität durch <strong>die</strong> Gesellschaft<br />
des Ancien Régime. Es sei eine Epoche der Transition, in der Bestialität nicht mehr<br />
ausschließlich als Werk des Bösen aufgefasst wurde, aber noch nicht völlig zum<br />
menschlichen Akt an sich geworden sei (Léchot 2001:140) – ein Schluss, der meiner<br />
Ansicht nach zu sehr dem Modernisierungsparadigma verhaftet ist.<br />
P. G. Maxwell-Stuart untersucht in einem 2003 erschienenen Aufsatz <strong>die</strong><br />
Verfolgung von Bestialität im frühneuzeitlichen Schottland (Maxwell-Stuart<br />
2003:82-93). Auf der Basis von 77 Prozessen, <strong>die</strong> zwischen 1570 und 1734 vor<br />
kirchlichen Gerichten anhängig gemacht wurden, zeigt Maxwell-Stuart vor allem<br />
<strong>die</strong> religiös geprägte Abscheu vor dem sexuellen Umgang mit Tieren auf.<br />
Der kurze, im Jahr 2000 erschienene Essay von Erica Fudge zu Bestialität im<br />
frühneuzeitlichen England (2000a:20-25) geht der Frage nach, weshalb Sodomie<br />
24