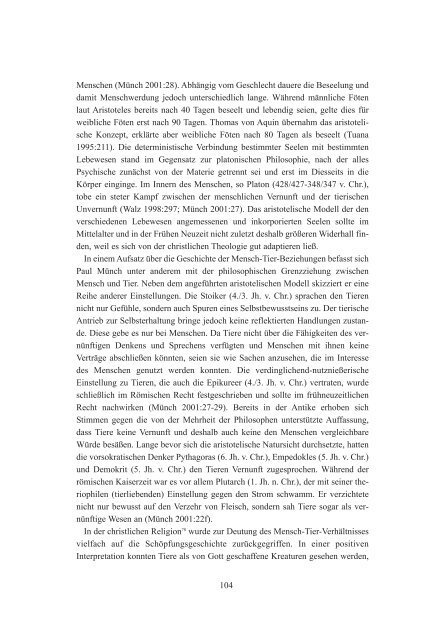Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Menschen (Münch 2001:28). Abhängig vom Geschlecht dauere <strong>die</strong> Beseelung und<br />
damit Menschwerdung jedoch unterschiedlich lange. Während männliche Föten<br />
laut Aristoteles bereits nach 40 Tagen beseelt und lebendig seien, gelte <strong>die</strong>s für<br />
weibliche Föten erst nach 90 Tagen. Thomas von Aquin übernahm das aristotelische<br />
Konzept, erklärte aber weibliche Föten nach 80 Tagen als beseelt (Tuana<br />
1995:211). Die deterministische Verbindung bestimmter Seelen mit bestimmten<br />
Lebewesen stand im Gegensatz zur platonischen Philosophie, nach der alles<br />
Psychische zunächst von der Materie getrennt sei und erst im Diesseits in <strong>die</strong><br />
Körper einginge. Im Innern des Menschen, so Platon (428/427-348/347 v. Chr.),<br />
tobe ein steter Kampf zwischen der menschlichen Vernunft und der tierischen<br />
Unvernunft (Walz 1998:297; Münch 2001:27). Das aristotelische Modell der den<br />
verschiedenen Lebewesen angemessenen und inkorporierten Seelen sollte im<br />
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit nicht zuletzt deshalb größeren Widerhall finden,<br />
weil es sich von der christlichen Theologie gut adaptieren ließ.<br />
In einem Aufsatz über <strong>die</strong> Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen befasst sich<br />
Paul Münch unter anderem mit der philosophischen Grenzziehung zwischen<br />
Mensch und Tier. Neben dem angeführten aristotelischen Modell skizziert er eine<br />
Reihe anderer Einstellungen. Die Stoiker (4./3. Jh. v. Chr.) sprachen den Tieren<br />
nicht nur Gefühle, sondern auch Spuren eines Selbstbewusstseins zu. Der tierische<br />
Antrieb zur Selbsterhaltung bringe jedoch keine reflektierten Handlungen zustande.<br />
Diese gebe es nur bei Menschen. Da Tiere nicht über <strong>die</strong> Fähigkeiten des vernünftigen<br />
Denkens und Sprechens verfügten und Menschen mit ihnen keine<br />
Verträge abschließen könnten, seien sie wie Sachen anzusehen, <strong>die</strong> im Interesse<br />
des Menschen genutzt werden konnten. Die verdinglichend-nutznießerische<br />
Einstellung zu Tieren, <strong>die</strong> auch <strong>die</strong> Epikureer (4./3. Jh. v. Chr.) vertraten, wurde<br />
schließlich im Römischen Recht festgeschrieben und sollte im frühneuzeitlichen<br />
Recht nachwirken (Münch 2001:27-29). Bereits in der Antike erhoben sich<br />
Stimmen gegen <strong>die</strong> von der Mehrheit der Philosophen unterstützte Auffassung,<br />
dass Tiere keine Vernunft und deshalb auch keine den Menschen vergleichbare<br />
Würde besäßen. Lange bevor sich <strong>die</strong> aristotelische <strong>Natur</strong>sicht durchsetzte, hatten<br />
<strong>die</strong> vorsokratischen Denker Pythagoras (6. Jh. v. Chr.), Empedokles (5. Jh. v. Chr.)<br />
und Demokrit (5. Jh. v. Chr.) den Tieren Vernunft zugesprochen. Während der<br />
römischen Kaiserzeit war es vor allem Plutarch (1. Jh. n. Chr.), der mit seiner theriophilen<br />
(tierliebenden) Einstellung gegen den Strom schwamm. Er verzichtete<br />
nicht nur bewusst auf den Verzehr von Fleisch, sondern sah Tiere sogar als vernünftige<br />
Wesen an (Münch 2001:22f).<br />
In der christlichen Religion 78 wurde zur Deutung des Mensch-Tier-Verhältnisses<br />
vielfach auf <strong>die</strong> Schöpfungsgeschichte zurückgegriffen. In einer positiven<br />
Interpretation konnten Tiere als von Gott geschaffene Kreaturen gesehen werden,<br />
104