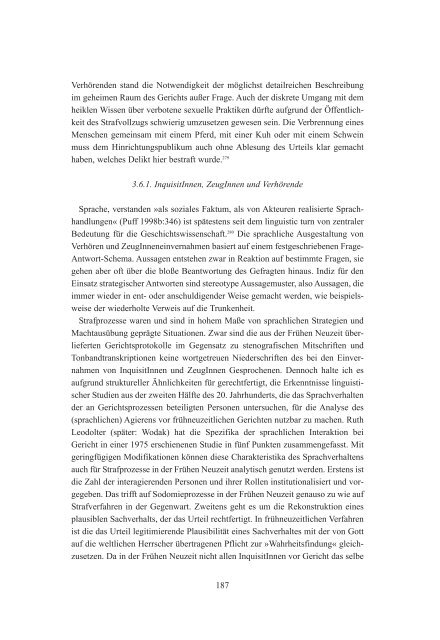Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Susanne Hehenberger / Unkeusch wider die Natur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verhörenden stand <strong>die</strong> Notwendigkeit der möglichst detailreichen Beschreibung<br />
im geheimen Raum des Gerichts außer Frage. Auch der diskrete Umgang mit dem<br />
heiklen Wissen über verbotene sexuelle Praktiken dürfte aufgrund der Öffentlichkeit<br />
des Strafvollzugs schwierig umzusetzen gewesen sein. Die Verbrennung eines<br />
Menschen gemeinsam mit einem Pferd, mit einer Kuh oder mit einem Schwein<br />
muss dem Hinrichtungspublikum auch ohne Ablesung des Urteils klar gemacht<br />
haben, welches Delikt hier bestraft wurde. 279<br />
3.6.1. InquisitInnen, ZeugInnen und Verhörende<br />
Sprache, verstanden »als soziales Faktum, als von Akteuren realisierte Sprachhandlungen«<br />
(Puff 1998b:346) ist spätestens seit dem linguistic turn von zentraler<br />
Bedeutung für <strong>die</strong> Geschichtswissenschaft. 280 Die sprachliche Ausgestaltung von<br />
Verhören und ZeugInneneinvernahmen basiert auf einem festgeschriebenen Frage-<br />
Antwort-Schema. Aussagen entstehen zwar in Reaktion auf bestimmte Fragen, sie<br />
gehen aber oft über <strong>die</strong> bloße Beantwortung des Gefragten hinaus. Indiz für den<br />
Einsatz strategischer Antworten sind stereotype Aussagemuster, also Aussagen, <strong>die</strong><br />
immer wieder in ent- oder anschuldigender Weise gemacht werden, wie beispielsweise<br />
der wiederholte Verweis auf <strong>die</strong> Trunkenheit.<br />
Strafprozesse waren und sind in hohem Maße von sprachlichen Strategien und<br />
Machtausübung geprägte Situationen. Zwar sind <strong>die</strong> aus der Frühen Neuzeit überlieferten<br />
Gerichtsprotokolle im Gegensatz zu stenografischen Mitschriften und<br />
Tonbandtranskriptionen keine wortgetreuen Niederschriften des bei den Einvernahmen<br />
von InquisitInnen und ZeugInnen Gesprochenen. Dennoch halte ich es<br />
aufgrund struktureller Ähnlichkeiten für gerechtfertigt, <strong>die</strong> Erkenntnisse linguistischer<br />
Stu<strong>die</strong>n aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, <strong>die</strong> das Sprachverhalten<br />
der an Gerichtsprozessen beteiligten Personen untersuchen, für <strong>die</strong> Analyse des<br />
(sprachlichen) Agierens vor frühneuzeitlichen Gerichten nutzbar zu machen. Ruth<br />
Leodolter (später: Wodak) hat <strong>die</strong> Spezifika der sprachlichen Interaktion bei<br />
Gericht in einer 1975 erschienenen Stu<strong>die</strong> in fünf Punkten zusammengefasst. Mit<br />
geringfügigen Modifikationen können <strong>die</strong>se Charakteristika des Sprachverhaltens<br />
auch für Strafprozesse in der Frühen Neuzeit analytisch genutzt werden. Erstens ist<br />
<strong>die</strong> Zahl der interagierenden Personen und ihrer Rollen institutionalisiert und vorgegeben.<br />
Das trifft auf Sodomieprozesse in der Frühen Neuzeit genauso zu wie auf<br />
Strafverfahren in der Gegenwart. Zweitens geht es um <strong>die</strong> Rekonstruktion eines<br />
plausiblen Sachverhalts, der das Urteil rechtfertigt. In frühneuzeitlichen Verfahren<br />
ist <strong>die</strong> das Urteil legitimierende Plausibilität eines Sachverhaltes mit der von Gott<br />
auf <strong>die</strong> weltlichen Herrscher übertragenen Pflicht zur »Wahrheitsfindung« gleichzusetzen.<br />
Da in der Frühen Neuzeit nicht allen InquisitInnen vor Gericht das selbe<br />
187