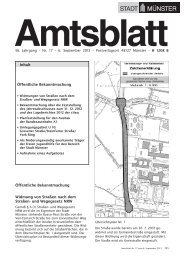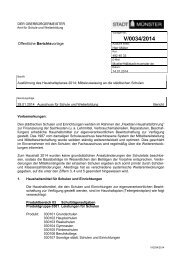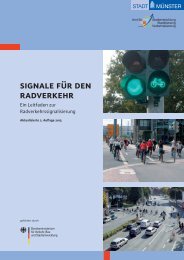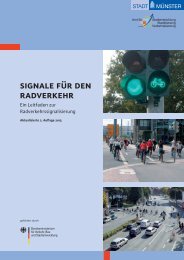Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
118<br />
oder auf eine Bedrohung des Arbeitsplatzes zu sehen sind, wobei auch Unzufriedenheit mit der Situation am<br />
Arbeitsplatz oder mit der Entlohnung eine Rolle spielen. Nicht selten jedoch treten Push- und Pullfaktoren auch<br />
gemeinsam auf. Die Gründungsforschung ist sich darin einig, dass <strong>für</strong> den Schritt in die <strong>Selbständig</strong>keit kaum<br />
ein einzelnes Motiv sondern immer eher ein Bündel an Beweggründen verantwortlich ist. 121<br />
Bereits in Kapitel 6.1 (qualitativer Untersuchungsteil) wurde eine Reihe an Beispielen aufgelistet, die einen<br />
ersten Einblick in die Motivlagen der Gründerinnen mit Migrationshintergrund boten, wobei diese Auswahl<br />
zunächst willkürlich war. Im Folgenden gehen wir daher der quantitativen Bedeutung einzelner Push- und<br />
Pullfaktoren nach. Wir beginnen mit den Anreizen, auch deswegen, weil dies Gelegenheit gibt, eine häufig vernachlässigte<br />
Dimension in der „Motivforschung“ zu ergründen: Denn eine zentrale Frage ist, über welchen<br />
Zeitraum und mit welch planerischer Voraussicht der Gründungswunsch entwickelt wurde.<br />
Zeitrahmen der Entwicklung von Motiven: Wann entstand der Gründungswunsch?<br />
Motive zur Gründung eines Unternehmens können sich spontan bzw. in kurzer Abfolge entwickeln, wenn sie<br />
aufgrund eines bestimmten Ereignisses mehr oder weniger plötzlich bzw. aus der Situation heraus „geboren“<br />
werden. Zumeist jedoch reift der Gedanke oder der Wunsch, sich selbständig zu machen, über einen längeren<br />
Zeitraum heran und ist bspw. durch Rollenmodelle und entsprechende Fähigkeiten geformt. 122 Und erst dann gelangt<br />
der Gedanke möglicherweise durch eine sich bietende Gelegenheit (oder durch einen Handlungszwang) in<br />
den finalen Umsetzungsprozess. D.h., Wunsch und Fähigkeiten ergänzen und entwickeln sich unter Umständen<br />
zu einem adäquaten unternehmerischen Potenzial. 123 Während wir uns zuvor schon den unternehmerischen<br />
Fähigkeiten und selbständigkeitsrelevanten Ressourcen gewidmet haben (Kapitel 8), interessiert natürlich genauso,<br />
wie lange überhaupt ein Gründungswunsch heranreift bis er realisiert wird. Die Phase bis zur Umsetzung<br />
ist ein wichtiger Modus im Planungs- und Gründungsprozess. Denn je länger der gehegte Wunsch oder gar der<br />
gefasste Beschluss zurückliegt desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person zuvor mit den<br />
Erfordernissen einer unternehmerischen Karriere befasst hat. 124 Umgekehrt führen kürzere Planungsphasen<br />
möglicherweise zu unbedachten Entscheidungen und Fehlern. 125 Es geht also darum, zu ermitteln, ob es sich<br />
bei den Gründungen von Migrantinnen um längerfristig geplante Projekte oder um eher spontane Aktionen<br />
handelt, die sich etwa aus den situativen Bedingungen (bspw. einer Notlage) ergeben können.<br />
Die Gründer/innen bzw. Unternehmer/innen wurden gefragt, wann ihnen zum ersten Mal die Idee kam, sich<br />
selbständig zu machen, wobei die Angaben sowohl Jahre als auch Monate umfassen durften. Die durchschnittlich<br />
von den einzelnen Ethnien verwendete Zeit von der ersten Idee bis zur Umsetzung des Vorhabens liegt (abgesehen<br />
von den italienischen und polnischen Männern) in einem Korridor zwischen zwei und drei Jahren (Abb.<br />
10.2.1; Anhang). Unter den Frauen lassen sich anhand der Mittelwerte kaum Unterschiede identifizieren. In<br />
dieser Sicht bleiben die Unternehmerinnen tendenziell in der Planungsdauer hinter ihren männlichen Pendants<br />
zurück. Während die <strong>Selbständig</strong>keit <strong>für</strong> Männer eher ein langfristig anvisiertes Ziel darstellt, entscheiden sich<br />
Frauen etwas häufiger in kürzerer Zeit.<br />
Wie spontan sind die Gründungsentscheidungen von Migrantinnen und Migranten im Vergleich mit den<br />
Einheimischen sowie im Vergleich der Gruppen? Bisherige Untersuchungen zeigen, dass Migranten ihre<br />
Entscheidung <strong>für</strong> den Schritt in die <strong>Selbständig</strong>keit schneller in die Tat umsetzen als Einheimische. 126 Diese<br />
Spontaneität mag aber unter Umständen auch ein Ergebnis dessen sein, dass Migranten häufiger aus der Not<br />
bzw. aus der Nichterwerbstätigkeit gründen (siehe vorheriger Abschnitt) oder auch zuvor schon zu einem höheren<br />
Anteil als die deutschen Gründer/innen <strong>Selbständig</strong>keitserfahrung sammeln konnten (siehe Kapitel 8.2).<br />
Es ist naheliegend, dass sich Personen, die sich aus einer prekären Lage, wie etwa aus der Arbeitslosigkeit, befreien<br />
müssen, in einem kürzeren Zeitraum Entscheidungen treffen, an die sie zuvor noch nie gedacht hatten.<br />
121 Welter/ Rosenbladt 1998.<br />
122 Zum Beispiel durch die soziale Herkunft bzw. die <strong>Selbständig</strong>keit der Eltern. Vgl. auch Kapitel 8.<br />
123 Ähnlich auch das Modell von Krueger/ Brazeal 1994.<br />
124 Vgl. auch Leicht/ Leiß 2007.<br />
125 Dowling 2002.<br />
126 Leicht et al. 2005b sowie Leicht/ Leiß 2007.