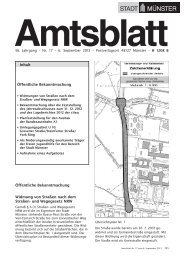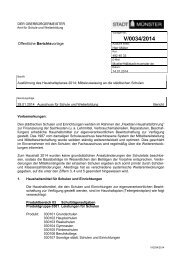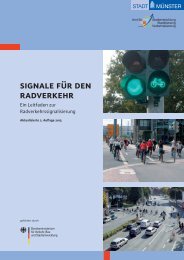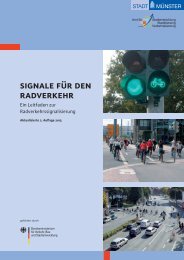Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12<br />
welches die förderlichen und hemmenden Faktoren <strong>für</strong> Migrantinnen im Gründungsprozess sind, welche<br />
Unterstützungsleistungen von familiärer und institutioneller Seite kommen und welche Strategien, Bedarfe<br />
und Probleme (z.B. Kapitalzugang) sie formulieren,<br />
wie die betrieblichen Leistungspotentiale einzuschätzen sind, insbesondere ob und wie viele Arbeitsplätze<br />
am Unternehmen hängen, welche Umsatzstärke und Erträge sie aufweisen und ob die Betriebe eine<br />
Ausbildungsbefähigung und -bereitschaft aufweisen.<br />
Diesen und den im Folgenden im Detail beschriebenen Fragen (vgl. auch Kapitel 2 zum Stand der Forschung)<br />
geht die vorliegende Studie nach.<br />
Auswahl der zu untersuchenden Zielgruppen<br />
Mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand stehen mehrere Zielgruppen im Fokus. So werden nicht nur Frauen<br />
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, sondern genauso die Männer als Referenzgruppe hinzugezogen und<br />
neben den <strong>Selbständig</strong>en teils auch abhängig Beschäftigte vergleichend betrachtet. Notwendig war aber insbesondere<br />
eine weitere Differenzierung der Gruppe selbständiger Migrantinnen und Migranten.<br />
Naheliegend ist, dass hier die (derzeitigen und künftigen) Potenziale an Gründer/innen der in Nordrhein-<br />
Westfalen bevölkerungsstärksten Migrantengruppen ausgewählt wurden. An deren Spitze stehen die aus der<br />
Türkei mit über 868.000, aus Polen mit 187.000, aus Italien mit 180.000 und aus der Russischen Förderation<br />
mit 144.000. 20 Wie sich die Geschlechter aufteilen, ist in Abb. 1.1 zu sehen. Der Frauenanteil ist unter den osteuropäischen<br />
Gruppen wesentlich höher. Die Gruppengröße war jedoch nicht das allein ausschlaggebende<br />
Kriterium <strong>für</strong> die Auswahl:<br />
Ein leitendes Prinzip in der Vorgehensweise bestand zudem darin, die je nach ethnischer Herkunft unterschiedlichen<br />
Ausgangsbedingungen <strong>für</strong> den Schritt in die <strong>Selbständig</strong>keit zu berücksichtigen. Gleichzeitig war jedoch<br />
klar, dass die Vielzahl an kulturellen Herkunftsgruppen keinen angemessenen Platz in einer Untersuchung finden<br />
kann, die einerseits Untersuchungseinheiten (Ethnien) voneinander abgrenzen muss und andererseits auf<br />
eine ausreichende Fallzahl an Beobachtungen innerhalb der Einheiten angewiesen ist. Ohnehin erscheint es<br />
sinnvoll, die Untersuchungsgruppen so zu bestimmen, dass die Erkenntnisse in einen Zusammenhang mit den<br />
divergierenden Optionen und Hürden gebracht werden können. Unterschiede in den Ausgangsbedingungen<br />
ergeben sich – wie im Folgenden noch dargelegt – etwa aus den Zuwanderungsphasen und -motiven sowie<br />
v.a. aus den <strong>für</strong> die Gruppen geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Ob eine Migrantin oder ein Migrant<br />
aus den ehemaligen Anwerbestaaten oder aus den Ländern Osteuropas kommt hat erhebliche Konsequenzen<br />
<strong>für</strong> die Ausstattung mit den aus dem Herkunftsland „mitgebrachten“ oder in Deutschland erworbenen<br />
Ressourcen (Differenzen bzgl. Bildung, <strong>Selbständig</strong>entradition, Aufenthaltsdauer, Sprachkenntnisse usw.).<br />
Vor allem jedoch sind die Zuwanderinnen unterschiedlichen institutionellen Regulierungen unterworfen, die<br />
über das Recht der freien Niederlassung und damit über die Möglichkeit zur Ausübung einer selbständigen<br />
Erwerbsarbeit entscheiden. 21 Dieses Recht steht (mit wenigen Ausnahmen) nur den EU-Bürgern zu, weshalb<br />
bei der Zielgruppenauswahl vorrangig auch zwischen Unions- und Drittstaatsangehörigen unterschieden<br />
wurde.<br />
Die genannten Differenzierungskriterien harmonieren ideal mit den bevölkerungsstarken vier Zielgruppen:<br />
Italiener/innen und Pol(inn)en, die zwar EU-Bürger, aber zum einen ehemalige Gastarbeiter oder deren Nachfahren<br />
und zum anderen Angehörige der neuen Mitgliedstaaten sind. Ferner Türk(inn)en und Russ(inn)en, die<br />
beide nicht der EU zugehören und sich zum anderen jedoch durch ihren Migrationstyp (Nicht-/Anwerbestaat)<br />
unterscheiden. Dieses Auswahlmuster ist anhand einer Vierfeldertafel in Abb. 1.1 dargestellt.<br />
20 Hier einschließlich der eingebürgerten Deutschen mit früherer Staatsangehörigkeit dieser Länder, wobei mit diesen Zahlen im Gegensatz<br />
zu unserer Untersuchung die Spätaussiedler/innen vorerst noch ausgeklammert sind.<br />
21 Die Niederlassungsfreiheit <strong>für</strong> EU-Angehörige umfasst die „Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten“ (Art. 43 EGV) soweit auch die<br />
landesspezifischen Qualifikationsanforderungen erfüllt sind (Art. 47 Abs. 1,2).