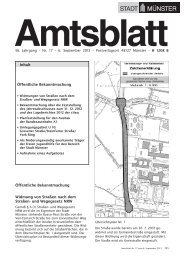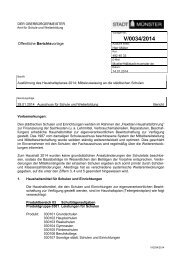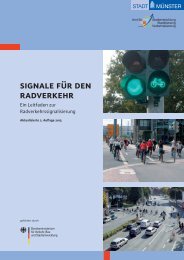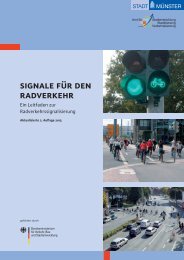Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
einer Familie erst nach der Unternehmensgründung vorgesehen war. Nimmt man jedoch den Familienstand<br />
zum Zeitpunkt der Befragung, dann wächst <strong>für</strong> diejenigen die Bedeutung des Vereinbarkeitsmotivs, die derzeit<br />
Kinder im Haushalt haben: Hier erhöhen sich die Werte bei allen Gruppen um einige Prozentpunkte, am stärksten<br />
jedoch bei den deutschen Frauen. 134<br />
Zusätzlich haben wir den Einfluss weiterer Faktoren auf die Zustimmung zum Motiv der „Vereinbarkeit“ mittels<br />
einer logistischen Regression (Tabelle 10.2.6 im Anhang) geprüft. Anhand der multivariaten Analyse zeigt sich,<br />
dass hier bspw. das Lebensalter und der Grad der Bildung keinen signifikanten Einfluss nimmt. Dagegen erhöht<br />
das Vorhandensein von Kindern im Haushalt die Relevanz des Vereinbarkeitsmotivs beträchtlich.<br />
Allerdings ist bei allem zu beachten, dass in den beschriebenen Ergebnissen bisher nur die Motivlagen derjenigen<br />
Frauen und Männer gegeneinander verglichen wurden, die sich auch tatsächlich selbständig gemacht<br />
haben. Anders stellt sich die Situation dar, wenn die Bedeutung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf anhand<br />
eines Vergleichs mit den abhängig Beschäftigten der jeweiligen Gruppen bemessen wird (vgl. hierzu Kapitel<br />
15.3). Hier zeigt sich dann, dass die Vereinbarkeitsproblematik insbesondere <strong>für</strong> die türkischstämmigen Frauen<br />
hohe Relevanz besitzt und die Wahrscheinlichkeit der Gründung eines eigenen Unternehmens deutlich erhöht.<br />
Motiv: Leistungsbereitschaft und Machbarkeitsdenken<br />
Ein Anreiz <strong>für</strong> den Schritt in die <strong>Selbständig</strong>keit mag darüber hinaus auch durch eine ausgeprägte<br />
Leistungsbereitschaft oder ein Machbarkeitsdenken gegeben sein. Insbesondere ein ausgeprägter Leistungswille<br />
gilt in der Entrepreneurship-Forschung als eine zentrale Voraussetzung <strong>für</strong> unternehmerisches Wirken.<br />
Bereits Max Weber 135 hob diesbezüglich die innere Motivation und den Willen hervor, die eigene Leistungsfähigkeit<br />
durch „rastloses Schaffen“ unter Beweis zu stellen. 136 Dieses Streben könnte bei einer „Arbeit auf eigene<br />
Rechnung“ möglicherweise viel eher zum Erfolg führen als in einer abhängigen Beschäftigung. Ein Indikator <strong>für</strong><br />
einen solchen Pull-Effekt ist das Motiv in der <strong>Selbständig</strong>keit die „Qualifikation besser verwerten“ oder die „eigenen<br />
Ideen besser verwirklichen“ zu können. Diese Motive sind bereits in engem Zusammenhang mit solchen<br />
Anreizen zu sehen, die sich aus bestimmten Chancen auf den Märkten bzw. Gelegenheitsstrukturen oder durch<br />
die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs ergeben. (Beides wird nachfolgend noch betrachtet.)<br />
Das Gründungsmotiv, die eigenen „Fähigkeiten und Qualifikationen besser verwerten zu können“, nimmt eine<br />
ähnlich wichtige Bedeutung ein, wie schon der Wunsch nach Autonomie. Insbesondere <strong>für</strong> die Migrantinnen:<br />
Jeweils rund drei Viertel aller Frauen (zwischen 70% bis 77%) gaben an, dass die Qualifikationsverwertung <strong>für</strong><br />
sie ein wichtiges Motiv <strong>für</strong> die <strong>Selbständig</strong>keit war (Abb. 10.2.7). Die deutschen Frauen halten dieses Motiv zwar<br />
<strong>für</strong> etwas weniger wichtig als die Migrantinnen, aber auch dort liegt der Anteil bei 62%. Diese Differenz dürfte<br />
wohl aus dem Umstand resultieren, dass Migrantinnen geringere Chancen sehen, ihr Leistungsvermögen in<br />
einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis adäquat zu beweisen.<br />
Sie üben häufig ausbildungsinadäquate Tätigkeiten aus und selbst Höherqualifizierte werden unter ihrem<br />
Wert beschäftigt. Vor allem Migrant(inn)en aus Polen und der ehemaligen Sowjetunionen sind häufig mit<br />
dem Problem konfrontiert, dass sie zwar über teilweise hochwertige Berufsabschlüsse verfügen, diese aber in<br />
Deutschland nicht anerkannt werden. 137 Es ist daher auch nicht überraschend, dass diese beiden Ethnien hier<br />
deutlich häufiger das Motiv der Qualifikationsverwertung nennen als deutsche Frauen.<br />
Ganz offensichtlich tritt dieses Problem auch bei den Männern auf, aber bei den polnisch- und russischstämmigen<br />
Männern in etwas geringem Maße als bei den Frauen. Geschlechterunterschiede zeigen sich insbesondere<br />
zwischen den Frauen und Männern aus der Türkei: Dies mag ein Hinweis darauf sein, dass türkische Männer<br />
mit guter Ausbildung vielleicht noch eher als die Frauen einen Job als Arbeitnehmer bekommen.<br />
134 Die Werte erhöhen sich um etwa 4-6%-Punkte bei Migrantinnen. Von den deutschen Frauen mit Kindern im Haushalt hielten 54%<br />
dieses Motiv <strong>für</strong> zutreffend.<br />
135 Weber 1905 (Protestantische Ethik).<br />
136 Die klassischen Ansätze wurden vor allem von McClelland (1961) wieder aufgegriffen.<br />
137 Dietz 1995; Koller 1997.<br />
123