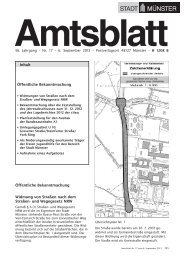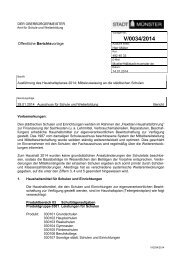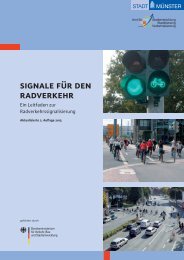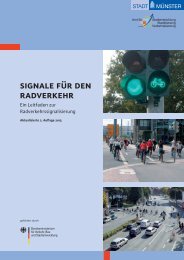Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diese Zweiteilung wird auch mit Blick auf die Durchschnittswerte und den Median deutlich (Tabelle 16.2.1). Die<br />
Hälfte der von uns befragten italienischstämmigen selbständigen Frauen ist bereits seit mehr als 15 Jahren<br />
auf dem Markt. Dieser Wert übertrifft sogar noch denjenigen der deutschen Frauen, von denen die Hälfte<br />
ihr Unternehmen höchstens seit 13 Jahren führt. Dies zeigt auch, dass ein beachtlicher Teil der italienischen<br />
Unternehmen in Deutschland eine lange Tradition besitzt. Zwar ist, wie wir gesehen haben (Kapitel 5.1.2), die<br />
Zahl der Betriebsschließungen am aktuellen Rand relativ hoch, doch viele der heute noch bestehenden italienischen<br />
Unternehmen werden von „Italiener/innen der ersten Stunde“ geführt, die einst vom Gastarbeiter- in<br />
den <strong>Selbständig</strong>enstatus wechselten. Deutlich jünger ist hingegen das Gros der Unternehmen von türkisch-<br />
und polnischstämmigen Frauen, von denen die Hälfte der Betriebe (Median) nicht länger als acht Jahre am<br />
Markt sind.<br />
Betriebsgrößen und Beschäftigungspotenzial<br />
Ein wichtiger Indikator zur Bestimmung der Leistungsstärke eines Unternehmens ist in der Anzahl der<br />
Beschäftigten zu sehen. In der Regel besitzen größere Betriebe eine höhere Bestandsfähigkeit als kleinere oder<br />
gar Kleinstgründungen. 259 Aber die Personalausstattung eines Unternehmens ist vor allem ein Näherungswert<br />
zur Beurteilung des gesamten betrieblichen Leistungsvermögens, da sie indirekt auf weitere Potenziale verweist.<br />
Bspw. korrelieren die Beschäftigtenzahl und Wertschöpfung einer Produktionseinheit relativ eng. 260 Aber<br />
zuvorderst verkörpert die Mitarbeiterzahl natürlich den Beschäftigungsbeitrag von Unternehmen. Vor diesem<br />
Hintergrund stellt sich dann die Frage, welche beschäftigungspolitische Bedeutung den von Migrant(inn)en geführten<br />
Unternehmen beizumessen ist. D.h., wie viele dieser Unternehmen schaffen nicht nur einen Arbeitsplatz<br />
<strong>für</strong> die Gründerin oder den Gründer, sondern können darüber hinaus noch zusätzliches Personal beschäftigen?<br />
Und wie groß sind die Betriebe von Migrant(inn)en im Vergleich zu denen der Deutschen?<br />
Zunächst liegt die Vermutung nahe, dass Migrantinnen im Vergleich zu einheimischen Gründerinnen ungünstigere<br />
Bedingungen zum Aufbau eines Unternehmens haben und daher die Beschäftigtenzahlen i.d.R. geringer<br />
ausfallen. Dies ist teils auf die Rahmenbedingungen der Migration, d.h., bspw. darauf zurückzuführen, dass ausländischstämmige<br />
<strong>Selbständig</strong>e weit seltener als Deutsche das Glück und die Chance besitzen, ein etabliertes<br />
und über Jahrzehnte gewachsenes Unternehmen durch Erbschaft bzw. Nachfolge zu übernehmen. Soweit es<br />
sich um neu Zugewanderte handelt, sind oftmals ungleich schwierigere Bedingungen gegeben, da der Auf-<br />
und Ausbau eines Unternehmens entsprechende Zeit und damit eine adäquate Aufenthaltsdauer erfordert.<br />
Andererseits gibt es aber auch genügend Beispiele, die zeigen, dass Migrantenunternehmer/innen die sich<br />
bietenden Chancen zu nutzen wussten und ihr Unternehmen relativ schnell auf den Wachstumspfad lenkten.<br />
Im ersten Schritt zur Einschätzung von Betriebsgrößen und Beschäftigungspotenzial stellt sich die Frage,<br />
wie viele Unternehmerinnen überhaupt noch zusätzliche Mitarbeiter/innen beschäftigen. Zunächst ist daher<br />
zwischen Ein-Personen-Unternehmen (sog. „Soloselbständigen“) und Mehrpersonen-Unternehmen zu unterscheiden.<br />
Grundsätzlich stehen zwei Datenquellen zur Ermittlung der Zahl an Soloselbständigen bzw. Ein-Personen-<br />
Unternehmen zur Verfügung: der Mikrozensus und unsere eigene Befragung. Die Fallzahlen im Mikrozensus sind<br />
(zumindest <strong>für</strong> Nordrhein-Westfalen und in einer Differenzierung nach ethnischer Herkunft und Geschlecht)<br />
jedoch sehr klein und vermitteln daher nur ein grobes Bild. Hingegen weisen die eigenen Befragungsdaten<br />
wesentlich mehr Fallzahlen, da<strong>für</strong> aber ein anderes Manko auf: Es ist davon auszugehen, dass mit unserer<br />
Erhebung die Summe an Soloselbständigen bzw. „kleinen“ <strong>Selbständig</strong>en unterschätzt wird, da viele nicht im<br />
Telefonbuch firmieren, das heißt bspw. im Privathaushalt arbeiten oder nicht beständig aktiv am Markt sind.<br />
Daher können Abweichungen gegenüber einer systematischen Flächen- und Haushaltsstichprobe wie dem<br />
Mikrozensus nicht ausgeschlossen werden, da hier auch solche <strong>Selbständig</strong>e erfasst werden, die nicht wirklich<br />
„wirtschaftlich aktiv“ sind.<br />
Aufgrund der hieraus resultierenden Ergebnisabweichungen berücksichtigen wir in Tabelle 16.2.2 zunächst<br />
beide Konzepte, wobei die Mikrozensusdaten <strong>für</strong> Nordrhein-Westfalen noch durch die <strong>für</strong> Gesamtdeutschland<br />
ergänzt wurden, um das Problem der geringen Fallzahlen zu kompensieren. Anhand des Mikrozensus wird ersichtlich,<br />
dass die soloselbständigen Frauen in allen Herkunftsgruppen zwischen der Hälfte und zwei Drittel<br />
aller Unternehmerinnen stellen. Und dies ist sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Gesamtdeutschland<br />
259 Brüderl 1998.<br />
260 Fritsch 1987; Leicht 1995.<br />
209