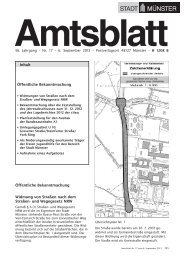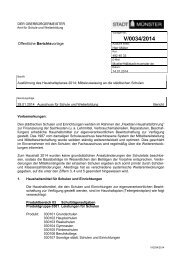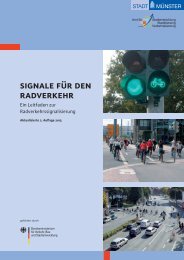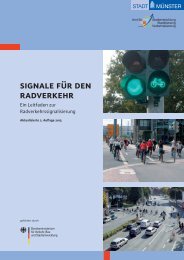Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
136<br />
die Gruppe von Bedeutung ist, während ein negativer Wert signalisiert, dass der Faktor <strong>für</strong> die jeweilige Ethnie<br />
keine Relevanz besitzt.<br />
Der Faktorenanalyse zufolge finden sich die „Markterobererinnen“ bzw. die Gründerinnen Schumpeter’schen<br />
Prägung vor allem bei den italienischen Frauen und Männern und zudem noch bei den türkischstämmigen<br />
Frauen, dort allerdings in etwas geringerem Maße. Dagegen ist der Typus der „Selbstverwirklicherinnen“<br />
am stärksten bei den polnisch- und russischstämmigen Frauen zu identifizieren. Dass dieser Typus in keiner<br />
Gruppe maßgeblich unter den Männern zu finden ist (nur schwach bei den Türken), verdeutlicht, wie<br />
sehr der Flexibilitätswunsch oder der Wunsch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein „weibliches“<br />
<strong>Selbständig</strong>keitsmodell ist. Fasst man mit Blick auf die Pull-Faktoren zusammen (und sieht von den italienischen<br />
Männern ab), dann lassen sich die von Anreizen getriebenen Motive viel eher bei den Frauen bzw. den<br />
Migrantinnen finden.<br />
Schaut man auf die Seite der Push-Faktoren und zunächst auf diejenigen, die aus „Unzufriedenheit“ gründeten,<br />
dann finden sich diese bei den Frauen und Männern türkischer Herkunft, aber auch bei italienischen<br />
Männern (in geringem Maß noch bei den Polen). Hingegen sind die „Notgründerinnen“ auf ein etwas breiteres<br />
Herkunftsspektrum verteilt: Sie sind bei den türkisch-, polnisch- und vor allem den russischstämmigen Frauen<br />
anzutreffen. Unter den Männern sind dies die Türken und in bescheidenerem Umfang die Polen.<br />
Es fällt auf, dass die Türkischstämmigen jeweils mehrere Typen verkörpern, da<strong>für</strong> mit etwas geringerer Relevanz.<br />
Bemerkenswert ist, dass sich die Deutschen zu keinem der vorgegebenen Typen so deutlich zuordnen lassen,<br />
dass positive Werte entstehen. Dies bedeutet nicht, dass Push- und Pullfaktoren dort keine Rolle spielen (siehe<br />
Kapitel 10.2), sondern nur, dass keine der Komponenten einen Typus ausreichend repräsentiert.<br />
11. Arbeitspensum, Einkommen und Zufriedenheit<br />
Die Debatte um das Für und Wider in der Frage, wie integrationsfördernd eine berufliche <strong>Selbständig</strong>keit überhaupt<br />
ist, wird maßgeblich entlang der Indikatoren zur ökonomischen Integration geführt. Dazu zählt an vorderster<br />
Stelle das durch die unternehmerische Tätigkeit erzielte Einkommen, welches teils aber in Verbindung<br />
mit der Arbeitsleistung bzw. Arbeitszeit bewertet wird. Denn eine gelungene Integration setzt voraus, dass der<br />
Wechsel in eine selbständige Erwerbsarbeit nicht mit Nachteilen erkauft und vor allem nicht mit einer marginalen<br />
Position verbunden ist.<br />
Der Blick auf das Arbeitspensum mag zunächst verwundern, geht aber auf den Verdacht zurück, dass sich<br />
Migrant(inn)en mangels ausreichender Qualifikationen vor allem in Sektoren mit niedrigen Zugangsbarrieren<br />
und daher in Bereichen mit starkem Konkurrenz- und Kostendruck bewegen. 166 Das Überleben am Markt wäre<br />
folglich nur durch die Kompensation mit ethnischen Ressourcen (z.B. Rückgriff auf Familienmitglieder) oder<br />
durch ein hohes Maß an Selbstausbeutung, d.h., durch starken Arbeitseinsatz möglich. 167 Andererseits jedoch<br />
gehen vom unternehmerischen Fleiß natürlich positive Zeichen aus, vor allem wenn er zu entsprechendem<br />
Erfolg und nicht zur Selbstausbeutung führt.<br />
Daher kommt dem Einkommen eine zentrale Bedeutung in der Bewertung der strukturellen Integration<br />
zu. Der Pfad in die <strong>Selbständig</strong>keit wird meist nur dann als Weg zur gesellschaftlichen Teilhabe verstanden,<br />
wenn sich auch die Verdienstmöglichkeiten verbessern. Während also den Erträgen selbständiger Migranten<br />
in Deutschland bisher – wenn überhaupt – insbesondere im Zusammenhang mit der Integrationswirkung<br />
Aufmerksamkeit zukommt, 168 nehmen Einkommensmessungen in der englischsprachigen Forschungsliteratur<br />
einen teils anderen Platz ein: Hier interessiert der Output nicht nur zur Feststellung der Opportunitätskosten<br />
beim Wechsel aus abhängiger Beschäftigung, sondern auch als Gradmesser des Aufstiegs innerhalb der eigenen<br />
Community. 169 D.h., ethnische Strategien werden eher als ökonomische Strategien betrachtet und nicht<br />
nur im strengen Kontext von Assimilation oder Integration gesehen.<br />
166 Waldinger et al. 1990; Özcan 2002; Loeffelholz/ Hernold 2001; Leicht et al. 2005.<br />
167 Bonacich 1993. Für Deutschland z.B. Yavuzcan 2003; Kontos 2005.<br />
168 Baumann 1999; Özcan/ Seifert 2000.<br />
169 Portes/ Zhou 1996; Li 2000; Lofstrom 2000;