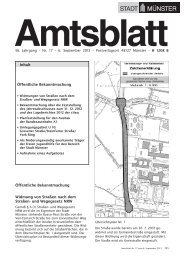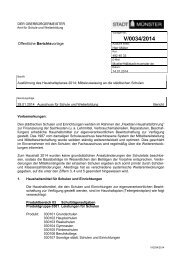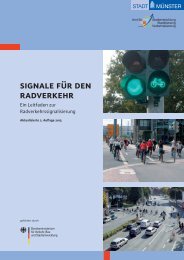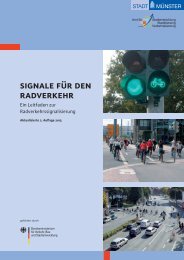Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
34<br />
Bildung ist auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestiegen. Allein von der Mitte der 90er Jahre bis zur Mitte<br />
dieses Jahrzehnts stieg die Erwerbsquote von Frauen in Nordrhein-Westfalen um rund 10 Prozentpunkte. 9<br />
Allerdings ist die Partizipation am Erwerbsleben noch immer geschlechterhierarchisch strukturiert. Ferner<br />
geht die zunehmende Erwerbsorientierung von Frauen häufig mit einer „modernisierten Versorgerehe“, 10 mit<br />
zunehmender Teilzeitbeschäftigung sowie unterbewerteter Arbeit und inadäquaten betrieblichen Stellungen<br />
einher. 11<br />
Noch ungünstiger sind die Erwerbs- und Arbeitsmarktchancen von Migrantinnen. Bereits die Phase der<br />
Anwerbung und Zuwanderung von „Gastarbeitern“ war von Männern dominiert, während Frauen vielfach erst<br />
im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen kamen. 12 Dies liegt zwar<br />
zeitlich weit zurück, doch Erwerbsmuster beruhen häufig auf überlieferten Verhaltensmustern. So stellt der<br />
Integrationsbericht Nordrhein-Westfalen (2008) noch fest, dass die Männer mit Migrationshintergrund eine<br />
Erwerbsquote 13 von 78% aufweisen und damit nur geringfügig unter der von autochthonen Männern liegen,<br />
während die Erwerbsquote von Frauen mit Migrationshintergrund bei 51% liegt. 14<br />
Da der Integrationsbericht Nordrhein-Westfalen nur die Erwerbsquoten von Migranten insgesamt und diejenigen<br />
mit türkischem Migrationshintergrund ausweist, wurden hier zudem die Erwerbsquoten der in dieser<br />
Untersuchung interessierenden Herkunftsgruppen berechnet (Tabelle 4.2.1). Zusätzlich wurde nach Deutschen<br />
mit Migrationshintergrund und Ausländern unterschieden sowie ein Vergleich mit den Quoten in Deutschland<br />
insgesamt vorgenommen.<br />
Mindestens vier Muster lassen sich diesbezüglich erkennen: erstens liegen die Erwerbsquoten über alle<br />
Gruppen und Migrationsstati hinweg bei den Frauen unter denen von Männern. Am stärksten fällt die<br />
Geschlechterdiskrepanz mit Blick auf die Türkinnen und Türken sowie die Russinnen und Russen ohne einen<br />
deutschen Pass aus. Hier ist die Erwerbsquote von Frauen nur halb so hoch wie die der Männer. Zweitens<br />
liegen die Erwerbsquoten – zumindest bei den Frauen – von denjenigen mit deutschem Pass jeweils höher<br />
als unter den Ausländerinnen, was nicht überrascht, da die u.a. darunter enthaltenen Eingebürgerten in<br />
Nordrhein-Westfalen wie in Deutschland insgesamt bekanntlich auch ansonsten einen höheren sozialen Status<br />
besitzen. 15 Drittens ist die Erwerbsbeteiligung von „eingebürgerten“ ehem. Polinnen (+Aussiedlerinnen) und<br />
Italienerinnen sogar höher als die der autochthonen Frauen. Die Polinnen schneiden ohnehin auch dann gut<br />
ab, wenn sie keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Und im Vergleich mit dem gesamten Bundesgebiet<br />
lässt sich viertens feststellen, dass die Erwerbsquoten fast durchgängig über alle Gruppen hinweg höher als in<br />
Nordrhein-Westfalen ausfallen.<br />
Besonders markant ist die geringe Arbeitsmarktintegration von Türkinnen und Russinnen ohne deutschen Pass,<br />
deren Erwerbsquote jeweils 36% beträgt. Hier dürfte darüber hinaus interessieren, dass die ausländischen<br />
türkischen Frauen der zweiten Generation demgegenüber eine um 12%-Punkte höhere Erwerbsbeteiligung<br />
aufweisen. Und wenn die hier geborenen türkischstämmigen Frauen einen deutschen Pass besitzen, liegt die<br />
Erwerbsquote sogar noch höher. 16<br />
Nach Dressel (2005) können ungünstige Bildungsabschlüsse, nicht-anerkannte Qualifikationen, kulturelle<br />
Familienleitbilder und eine größere Kinderzahl bei Migrantinnen einer höheren Erwerbsbeteiligung hinderlich<br />
sein. Dem kann an dieser Stelle nicht im Detail nachgegangen werden, aber es ist festzuhalten, dass insbesondere<br />
die Höhe der beruflichen Qualifikation einen deutlichen Einfluss auf die Erwerbsorientierung nimmt: Besitzen<br />
die Migrantinnen einen Hochschulabschluss, steigen bei den Frauen türkischer Herkunft die Erwerbsquoten auf<br />
das Doppelte. Nicht ganz so drastisch, aber ebenfalls eine starke Verbesserung in der Arbeitsmarktintegration<br />
zeigt sich mit Blick auf die hochqualifizierten Russinnen, Polinnen und Italienerinnen. Aber generell weisen<br />
auch schon diejenigen mit einem mittleren Abschluss (Lehre) eine weit höhere Erwerbsbeteiligung als diejenigen<br />
ohne einen Berufsabschluss auf. 17<br />
9 Sozialbericht NRW 2007, Tabelle V.1.4.<br />
10 Pfau-Effinger 2001.<br />
11 Engelbrech et al. 1997; Beckmann 2003; Cornelißen 2005.<br />
12 Westphal (2006) weist aber auch darauf hin, dass die Rolle von Frauen in dieser Zeit eher unterschätzt wurde.<br />
13 Erwerbsquote = Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige + Erwerbslose) an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter<br />
(15 bis unter 65 Jahre).<br />
14 Mikrozensusdaten <strong>für</strong> 2006. Ähnlich der Sozialbericht NRW 2007, der jedoch Daten von 2005 enthält.<br />
15 Vgl. MGFFI Integrationsbericht 2008; Santel 2008 sowie Salentin/ Wilkening 2003; Seifert 2007a.<br />
16 Beide Werte in der Tabelle nicht abgebildet.<br />
17 Auch hier aus Platzgründen nicht abgebildet.