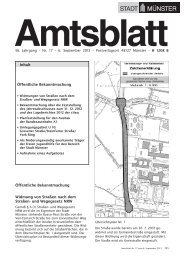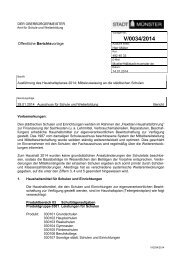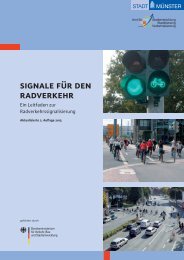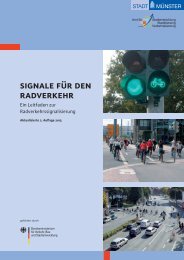Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
202<br />
unternehmerisch betätigen, sind sie zudem weit häufiger als die Arbeitnehmerinnen in qualifizierten oder<br />
(semi-)professionellen Berufen anzutreffen. Entscheidend hierbei ist, dass dies nicht ein Ergebnis ihrer höheren<br />
schulischen Bildung ist, da deren Effekt ja zusätzlich berücksichtigt wurde. Vielmehr kann hierin ein<br />
Mobilitätseffekt der <strong>Selbständig</strong>keit gesehen werden: Frauen mit vergleichbarem Bildungsniveau gelingt es in<br />
der <strong>Selbständig</strong>keit eher eine qualifizierte oder professionelle Tätigkeit auszuüben als ihren Pendants in einer<br />
abhängigen Beschäftigung (was im Übrigen auch unter dem Blickwinkel der Integrationsfrage von Bedeutung<br />
ist).<br />
Im Vergleich zu den türkischen lassen sich mit Blick auf italienische Migrantinnen nur wenige einflussreiche<br />
Determinanten finden (Tab. 15.2). Dies mag damit zusammenhängen, dass diese oftmals mit ihrem<br />
Lebenspartner ein gemeinsames Unternehmen gründen (vgl. Kapitel 12). Interessanterweise sind es unter<br />
den Italienischstämmigen vor allem die Männer, bei denen ein höherer Bildungsabschluss den Weg in<br />
die <strong>Selbständig</strong>keit ebnet (wobei sie dann trotzdem oftmals Gastwirt sind; vgl. Kap. 8.1). Immerhin arbeiten<br />
selbständige Italienerinnen häufiger als Arbeitnehmerinnen auf der Basis einer (semi-)professionellen<br />
Qualifikation.<br />
Eine gute Humankapitalausstattung in Form schulischer und beruflicher Bildung ist insbesondere <strong>für</strong> die osteuropäischen<br />
Frauen eine entscheidende Voraussetzung <strong>für</strong> unternehmerisches Engagement (Tab. 15.3a+b).<br />
In dieser Gruppe haben Akademikerinnen eine mehr als fünf mal so hohe Wahrscheinlichkeit selbständig<br />
zu sein als die ungelernten Frauen gleicher Herkunft. Dies ist in Anbetracht der zuvor schon beobachteten<br />
Präsenz „medizinischer“ Berufe (Kapitel 7.2) verständlich. Werden auch hier die Aussiedlerinnen ausgeklammert,<br />
steigt der Bildungseffekt sogar noch an. Doch neben den Hochschulabsolventinnen kommen bei den<br />
Osteuropäerinnen noch andere Qualifikationen ins Spiel: Ganz im Gegensatz zu den italienischen Frauen, bei<br />
denen (semi-)professionelle Berufe die stärkste Triebkraft in Richtung <strong>Selbständig</strong>keit entwickeln, sind es bei<br />
den Osteuropäerinnen in stärkerem Maße die Berufe mit einem mittleren Qualifikationsniveau, die zu einer<br />
Gründung führen. Diese Diskrepanz zu den Effekten formaler Bildung mag darauf zurückzuführen sein, dass<br />
die Osteuropäerinnen ihre zumeist im Herkunftsland erworbene Hochschulausbildung (vgl. Kapitel 8.1) weder<br />
in der abhängigen noch in einer selbständigen Beschäftigung adäquat einsetzen können, d.h., sie eher im Feld<br />
mittlerer Qualifikationsanforderungen tätig werden. Darüber hinaus dürfte überraschen, dass unter Männern<br />
osteuropäischer Herkunft das formale Bildungsniveau keine Rolle <strong>für</strong> die Entscheidung zu einer selbständigen<br />
Erwerbsarbeit spielt. Dies mag sicher auch daran liegen, dass hier vielfach vor allem handwerkliche Fähigkeiten<br />
„über die Grenze“ gebracht werden, was sich bspw. im Anstieg von Gründungsaktivitäten im Baugewerbe beweist.<br />
Bei Frauen und Männern deutscher Herkunft zeigt sich der aus vielen Studien bekannte positive Einfluss des<br />
Alters bzw. der Berufserfahrung 242 (Tab. 15.4; Anhang). Während formale Bildung unter den Erwerbstätigen<br />
nicht-deutscher Herkunft eine jeweils bei Frauen und Männern ganz unterschiedliche Bedeutung besitzt, erweist<br />
sich die schulische und berufliche Bildung bei Deutschen beiderlei Geschlechts als selbständigkeitsförderlich.<br />
Der Bildungseffekt bei deutschen Frauen ist jedoch nicht ganz so stark wie unter den Osteuropäerinnen.<br />
15.3 einfluss von Familie: Zur Bedeutung von Lebenspartner und Kindern<br />
Während es hier vor allem um die Bedeutung bzw. Stärke bestimmter Determinanten beruflicher <strong>Selbständig</strong>keit<br />
geht, sollte nicht vergessen werden, dass Frauen nach wie vor – und über alle Herkunftsgruppen hinweg –<br />
seltener als Männer ein Unternehmen gründen und führen (vgl. Kapitel 5). Die Entscheidung zur beruflichen<br />
<strong>Selbständig</strong>keit wird bei Frauen und Männern von teilweise divergierenden Ressourcen, Gelegenheiten und<br />
insbesondere von unterschiedlichen Restriktionen geleitet. Einige der hinderlichen Faktoren wurden bereits in<br />
den vorangegangenen Kapiteln vorgestellt und bewertet.<br />
Doch neben den institutionellen Rahmenbedingungen sind es vor allem die aus der Sozialisation und aus tradiertem<br />
Rollenverhalten resultierenden Faktoren – und damit auch Hürden im privaten Umfeld, welche Frauen eine<br />
unternehmerische Betätigung erschweren. Die mangelnden Möglichkeiten der Entwicklung und des Rückgriffs<br />
auf Ressourcen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den durch die Rollenmodelle hervorgerufenen<br />
242 in Form eines umgekehrt u-förmigen bzw. inversen Verlaufs. D.h., die Wahrscheinlichkeit der Ausübung einer beruflichen <strong>Selbständig</strong>keit<br />
steigt bis zu einer gewissen Altersgrenze kontinuierlich an und geht nach dieser Altersgrenze wieder zurück.