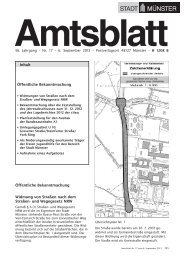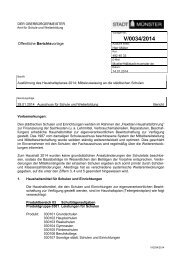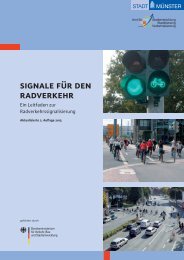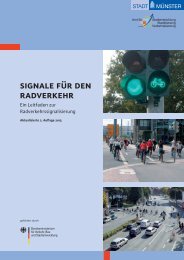Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22<br />
Migrantinnen in Deutschland mit drei mal geringerer Wahrscheinlichkeit als ihre männlichen Pendants selbständig<br />
machen. Leicht und Leiß (2006) stellen diesbezüglich etwas geringere Diskrepanzen fest. Eine auf<br />
Mikrozensusdaten beruhende bundesweite Untersuchung des ifm Mannheim zeigt auf, dass die geringe Zahl<br />
selbständiger Migrantinnen zu einem wesentlichen Teil auch das Ergebnis der geringen Erwerbsbeteiligung<br />
einzelner Herkunftsgruppen (v.a. von Türkinnen) ist. 97<br />
Grundsätzlich lassen sich die bislang <strong>für</strong> Deutschland vorliegenden Studien zum Gründungspotenzial von<br />
Frauen mit Migrationshintergrund auch danach unterscheiden, ob sich hierbei der Fokus auf Frauen in verschiedenen<br />
Erwerbspositionen oder aber nur auf die bereits selbständigen richtet. Die meisten der Untersuchungen<br />
beruhen auf einem Design, welches sich ausschließlich aus Daten über Frauen speist, die ihr Unternehmen<br />
zum Befragungszeitpunkt bereits gegründet haben. Somit liegen kaum Informationen über diejenigen vor,<br />
die dies vergeblich versuchten. 98 Welche Implikationen dies birgt, lässt sich indirekt aus den Ergebnissen des<br />
DtA-Gründungsmonitors 99 entnehmen (die aber leider keine Differenzierung nach Geschlecht und einzelnen<br />
Nationalitäten erlauben). Demnach lag der Anteil unter denjenigen, die eine geplante Gründung nicht realisieren<br />
konnten, bei den Migranten mit 29% fast doppelt so hoch wie bei den Deutschen, wobei zusätzlich 42% der<br />
Migranten (aber nur 31% der Deutschen) ihr Vorhaben „verschoben“ haben.<br />
<strong>Selbständig</strong>keit als Weg zu Unabhängigkeit und sozialem Aufstieg?<br />
Gibt es auf Grundlage bisheriger Untersuchungen bereits Anzeichen, dass der Weg in die <strong>Selbständig</strong>keit ein<br />
Zeichen <strong>für</strong> Autonomiebestrebungen und <strong>für</strong> strukturelle Integration ist? Dies wirft zunächst auch die Frage<br />
nach den Gründungsmotiven auf. Unter den wenigen durchgeführten Studien ist die Motivlage einer der am<br />
häufigsten untersuchten Faktoren. Die bisherigen Befunde waren sich darin einig, dass der Wunsch nach<br />
Eigenständigkeit und Selbstverantwortung ein zentraler Antrieb <strong>für</strong> Migrantinnen ist, wobei darauf hinzuweisen<br />
wäre, 100 dass dieses Motiv genauso auch bei Frauen deutscher Herkunft an oberster Stelle steht. 101 Ferner<br />
stellen Hayen und Unterberg (2008) in ihrer Befragung in Hannover fest, dass das Unabhängigkeitsstreben<br />
noch stärker bei männlichen Migranten beobachtbar ist. Dies entspricht in der Tendenz auch den Befunden<br />
aus der bundesweiten Befragung des ifm, wobei sich mit Blick auf Türk(inn)en keine Geschlechterunterschiede<br />
in diesem Punkt zeigen. 102<br />
Strukturelle Integration wird vor allem durch die Position am Arbeitsmarkt beeinflusst. Die Befreiung aus<br />
der Arbeitslosigkeit ist nach den Ergebnissen der Hannoveraner Studie eine zentrales Gründungsmotiv, dem<br />
sich fast ein Drittel zuordnet, wobei kaum ein Geschlechterunterschied besteht. 103 Unsere eigene bundesweit<br />
durchgeführte ifm-Erhebung geht von einem etwas geringeren Anteil aus, was möglicherweise aber auch auf<br />
unterschiedliche Beobachtungsphasen zurückzuführen ist. Ein Großteil der Migranten insgesamt gründet<br />
auch nicht allein aus einer Position der Erwerbslosigkeit, da viele – insbesondere Frauen – noch gar nicht formal<br />
ins Erwerbsleben eingetaucht sind. Die Erwerbsbeteiligung von Migrantinnen ist je nach Herkunftsgruppe<br />
schwankend, aber auch in Nordrhein-Westfalen besonders niedrig. 104<br />
Zur Frage, inwieweit der Weg in die <strong>Selbständig</strong>keit zur sozialen und wirtschaftlichen Besserstellung führt, liegen<br />
bzgl. Frauen nur wenige Einschätzungen vor, zumal kaum <strong>für</strong> Deutschland. Anhand des Sozioökonomischen<br />
Panels kommt Constant (2004) zu der Einschätzung, dass die Hypothese, <strong>Selbständig</strong>keit würde die sozioökonomische<br />
Position verbessern, nicht generell bestätigt werden könne, aber sie wäre eine Möglichkeit, um der<br />
Arbeitslosigkeit zu entrinnen und Beruf und Familie zu vereinbaren. Dieses Urteil widerspricht den zuvor erwähnten<br />
Ergebnissen von Özcan und Seifert. 105 Möglicherweise bestehen ohnehin starke Unterschiede hinsichtlich<br />
der Ausgangsposition und folglich auch der Aufstiegschancen einzelner Ethnien mit zudem unterschiedlichen<br />
Ressourcen. Bei all dem dürften Geschlechterdiskrepanzen zusätzlich Wirkung zeigen. Anhand einer explorativen<br />
Studie zur Situation von türkischen Migrantinnen bzw. Gründerinnen im Raum Berlin zieht Hillmann (1998)<br />
97 Leicht et al. 2005.<br />
98 Dies war einer der Gründe, weshalb wir die eigene Primärerhebung durch Mikrozensusanalysen ergänzten. Siehe Kapitel 3.<br />
99 DtA 2003.<br />
100 Dies ist das Ergebnis einer Befragung von türkischen Gründerinnen im Berliner Nahrungsmittelgewerbe (Hillmann/ Rudolph 1997)<br />
sowie auch mit Blick auf die von türkisch-, italienisch- und griechischstämmigen in einer bundesweiten und branchenübergreifenden<br />
Sicht (Leicht et al. 2004).<br />
101 Leicht et al. 2005.<br />
102 Leicht et al. 2005.<br />
103 Hayen/ Unterberg 2008.<br />
104 Siehe Kapitel 4.<br />
105 Die Analyse von Özcan/ Seifert (2000 und 2003) ist ohne Geschlechterdifferenzierung und daher in Kap. 2.2 erwähnt.