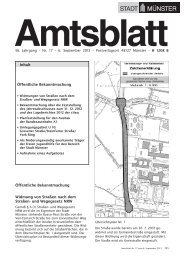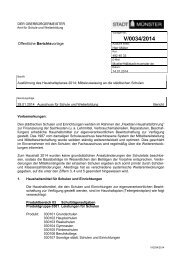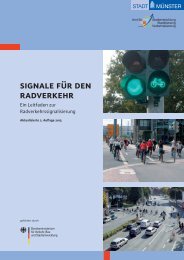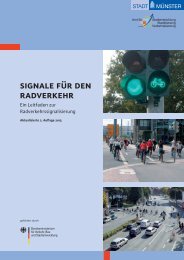Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Selbständig integriert? - Institut für Mittelstandsforschung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
234<br />
Frauen signifikant. Vor allem die Unternehmerinnen türkischer und russischer Herkunft arbeiten wöchentlich<br />
zwischen 7 bis 14 Stunden mehr als der Schnitt (nicht abgebildet). Leider haben wir keine Informationen über<br />
das hierdurch erzielte Nettoeinkommen. 313 Allerdings testen wir nachfolgend (Kapitel 17.3) den Einfluss dieser<br />
Strategie auf den subjektiven wirtschaftlichen Erfolg.<br />
Ein indirekter Indikator <strong>für</strong> die Ressourcenausstattung ist die Betriebsgröße. Zwar setzt sich die<br />
Untersuchungsgruppe zu einem deutlich höheren Anteil aus Kleinstbetrieben zusammen. Doch unter Kontrolle<br />
anderer Variablen verliert die Beschäftigungszahl der Betriebe an Einfluss.<br />
In welchem „ethnischen“ Umfeld arbeiten die der Selbstausbeutung verdächtigen Unternehmerinnen? Im<br />
Vergleich zu den übrigen <strong>Selbständig</strong>en zeigen sich kaum Unterschiede in Bezug auf ihre Kundenstruktur.<br />
Allerdings arbeiten die Frauen weit häufiger in Quartieren mit einer starken Konzentration an weiteren<br />
<strong>Selbständig</strong>en mit gleicher Herkunft. Dies ist unter den „Selbstausbeutenden“ mit 50% höherer<br />
Wahrscheinlichkeit der Fall als unter den <strong>Selbständig</strong>en insgesamt.<br />
Fasst man zusammen, spricht einiges da<strong>für</strong>, dass die auf einer Kombination von Mehrarbeit und Niedrigpreisen<br />
beruhenden Strategien zu einem großen Teil den Versuch darstellen, hierdurch den Mangel an adäquaten unternehmerischen<br />
Ressourcen zu kompensieren. In dieser Perspektive ist es berechtigt, dann zumindest bei<br />
diesen Betrieben von einer Strategie der Selbstausbeutung zu sprechen. Als „ethnische“ Strategie lässt sich<br />
eine solche zwar nicht unbedingt bezeichnen, da wohl auch viele kleine „deutsche“ Betriebe auf diese Art ihre<br />
Marktposition verteidigen.<br />
Es ist aber davon auszugehen, dass eine Strategie, die auf einem hohen Arbeitspensum, niedrigen Preisen<br />
und dem Mangel an Humankapital beruht (wenn überhaupt, dann) viel eher tragfähig ist, wenn hierbei wenigstens<br />
die Familienangehörigen mit eingespannt werden können und zudem das Beschäftigtenreservoir<br />
aus Landsleuten besteht. Eine Berücksichtigung dieser Variablen in den multivariaten Analysen erbringt jedoch<br />
keinen signifikanten Effekt. Dieser zeigt sich lediglich bivariat, d.h., die durchschnittlichen Anteile an<br />
Familienbeschäftigten sowie an co-ethnischen Beschäftigten liegen bei allen Herkunftsgruppen unter den sich<br />
„potenziell selbstausbeutenden“ Frauen deutlich höher als in der Referenzkategorie. 314 Hieran gemessen deutet<br />
sich an, dass die Untersuchungsgruppe versucht, ihr Überleben am Markt auch durch den Rückgriff auf<br />
„ethnische Ressourcen“ abzusichern. Aus diesem Blickwinkel bekommt die untersuchte Strategie dann eine<br />
„ethnische“ Komponente.<br />
17.2 mut, risikobereitschaft und ethnizität<br />
Strategien erfordern oftmals den Mut etwas Neues und Unkalkulierbares zu versuchen. Und dies betrifft nicht<br />
nur den Wagemut, den der Schritt in die <strong>Selbständig</strong>keit verlangt. Mut und eine gewisse Risikofreude sind teils<br />
auch dann erforderlich, wenn grundlegende Entscheidungen zur Positionierung oder zum weiteren Verbleib auf<br />
dem Markt anstehen.<br />
Risikobereitschaft wird bislang allerdings häufiger im Kontext der Gründungsneigung bestimmter Individuen<br />
oder Gruppen und weniger im Zusammenhang mit ihrem Verhalten in der täglichen Unternehmens(weiter)führung<br />
diskutiert. 315 Dies gilt zumindest <strong>für</strong> weite Teile der empirischen Forschung, wenngleich die neoklassischen<br />
„Entrepreneurship-Theorien“ durchaus nicht nur in der Person der Gründer(innen) sondern auch in der des<br />
Unternehmers 316 einen Risikoträger sehen und sich mit dem Zusammenspiel von unternehmerischer Wagnis<br />
und wirtschaftlichem Ertrag befassen. 317 Sowohl in der Gründungsforschung als auch in der öffentlichen Debatte<br />
kehren zwei Einschätzungen beständig wieder: So wird Frauen eine geringere Risikobereitschaft (bzw. größere<br />
Aversion) beim Schritt in die <strong>Selbständig</strong>keit zugeschrieben 318 und im Gegensatz hierzu gelten Migranten<br />
313 Dieses hatten wir in Kapitel 11.2 anhand der Mikrozensusdaten ermittelt.<br />
314 Die Unterschiede zwischen den Mittelwerten erweisen sich im T-Test jeweils als signifikant (zumindest <strong>für</strong> die weiblichen Herkunftsgruppen).<br />
315 Bspw. Spengler/ Tilleßen (KfW-Gründungsmonitor 2006); Köllinger/ Schade (2005) untersuchen bspw. den Einfluss von Optimismus,<br />
Selbstbewusstsein und Risikofreude auf das unterschiedliche Gründungsverhalten in Deutschland und den USA.<br />
316 Von „Unternehmerinnen“ ist in der deutschsprachigen Literatur seltener die Rede.<br />
317 Vor allem Knight (1921).<br />
318 Wagner 2006; Spengler/ Tilleßen (KfW-Gründungsmonitor 2006, S. 8); Metzger et al. 2008.