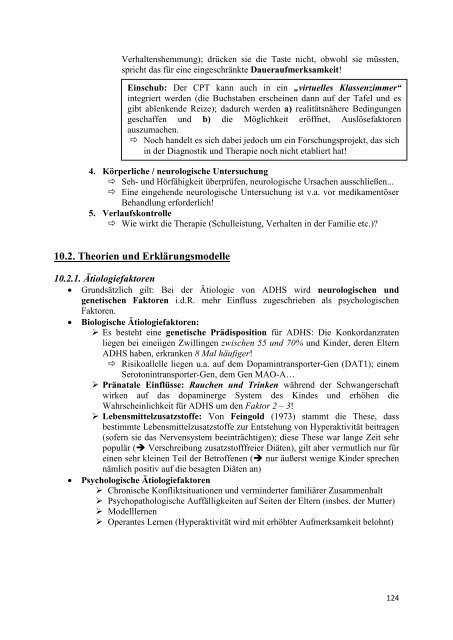KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Verhaltenshemmung); drücken sie die Taste nicht, obwohl sie müssten,<br />
spricht das für eine eingeschränkte Daueraufmerksamkeit!<br />
Einschub: Der CPT kann auch in ein „virtuelles Klassenzimmer“<br />
integriert werden (die Buchstaben erscheinen dann auf der Tafel und es<br />
gibt ablenkende Reize); dadurch werden a) realitätsnähere Bedingungen<br />
geschaffen und b) die Möglichkeit eröffnet, Auslösefaktoren<br />
auszumachen.<br />
Noch handelt es sich dabei jedoch um ein Forschungsprojekt, das sich<br />
in der Diagnostik und Therapie noch nicht etabliert hat!<br />
4. Körperliche / neurologische Untersuchung<br />
Seh- und Hörfähigkeit überprüfen, neurologische Ursachen ausschließen...<br />
Eine eingehende neurologische Untersuchung ist v.a. vor medikamentöser<br />
Behandlung erforderlich!<br />
5. Verlaufskontrolle<br />
Wie wirkt die Therapie (Schulleistung, Verhalten in der Familie etc.)?<br />
10.2. Theorien und Erklärungsmodelle<br />
10.2.1. Ätiologiefaktoren<br />
Grundsätzlich gilt: Bei der Ätiologie von ADHS wird neurologischen und<br />
genetischen Faktoren i.d.R. mehr Einfluss zugeschrieben als psychologischen<br />
Faktoren.<br />
Biologische Ätiologiefaktoren:<br />
Es besteht eine genetische Prädisposition für ADHS: Die Konkordanzraten<br />
liegen bei eineiigen Zwillingen zwischen 55 und 70% und Kinder, deren Eltern<br />
ADHS haben, erkranken 8 Mal häufiger!<br />
Risikoallelle liegen u.a. auf dem Dopamintransporter-Gen (DAT1); einem<br />
Serotonintransporter-Gen, dem Gen MAO-A…<br />
Pränatale Einflüsse: Rauchen und Trinken während der Schwangerschaft<br />
wirken auf das dopaminerge System des Kindes und erhöhen die<br />
Wahrscheinlichkeit für ADHS um den Faktor 2 – 3!<br />
Lebensmittelzusatzstoffe: Von Feingold (1973) stammt die These, dass<br />
bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe zur Entstehung von Hyperaktivität beitragen<br />
(sofern sie das Nervensystem beeinträchtigen); diese These war lange Zeit sehr<br />
populär ( Verschreibung zusatzstofffreier Diäten), gilt aber vermutlich nur für<br />
einen sehr kleinen Teil der Betroffenen ( nur äußerst wenige Kinder sprechen<br />
nämlich positiv auf die besagten Diäten an)<br />
Psychologische Ätiologiefaktoren<br />
Chronische Konfliktsituationen und verminderter familiärer Zusammenhalt<br />
Psychopathologische Auffälligkeiten auf Seiten der Eltern (insbes. der Mutter)<br />
Modelllernen<br />
Operantes Lernen (Hyperaktivität wird mit erhöhter Aufmerksamkeit belohnt)<br />
124