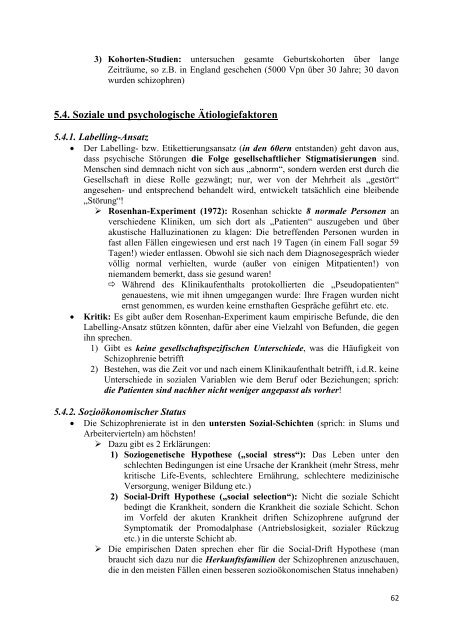KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3) Kohorten-Studien: untersuchen gesamte Geburtskohorten über lange<br />
Zeiträume, so z.B. in England geschehen (5000 Vpn über 30 Jahre; 30 davon<br />
wurden schizophren)<br />
5.4. Soziale und psychologische Ätiologiefaktoren<br />
5.4.1. Labelling-Ansatz<br />
Der Labelling- bzw. Etikettierungsansatz (in den 60ern entstanden) geht davon aus,<br />
dass psychische Störungen die Folge gesellschaftlicher Stigmatisierungen sind.<br />
Menschen sind demnach nicht von sich aus „abnorm“, sondern werden erst durch die<br />
Gesellschaft in diese Rolle gezwängt; nur, wer von der Mehrheit als „gestört“<br />
angesehen- und entsprechend behandelt wird, entwickelt tatsächlich eine bleibende<br />
„Störung“!<br />
Rosenhan-Experiment (1972): Rosenhan schickte 8 normale Personen an<br />
verschiedene Kliniken, um sich dort als „Patienten“ auszugeben und über<br />
akustische Halluzinationen zu klagen: Die betreffenden Personen wurden in<br />
fast allen Fällen eingewiesen und erst nach 19 Tagen (in einem Fall sogar 59<br />
Tagen!) wieder entlassen. Obwohl sie sich nach dem Diagnosegespräch wieder<br />
völlig normal verhielten, wurde (außer von einigen Mitpatienten!) von<br />
niemandem bemerkt, dass sie gesund waren!<br />
Während des Klinikaufenthalts protokollierten die „Pseudopatienten“<br />
genauestens, wie mit ihnen umgegangen wurde: Ihre Fragen wurden nicht<br />
ernst genommen, es wurden keine ernsthaften Gespräche geführt etc. etc.<br />
Kritik: Es gibt außer dem Rosenhan-Experiment kaum empirische Befunde, die den<br />
Labelling-Ansatz stützen könnten, dafür aber eine Vielzahl von Befunden, die gegen<br />
ihn sprechen.<br />
1) Gibt es keine gesellschaftspezifischen Unterschiede, was die Häufigkeit von<br />
Schizophrenie betrifft<br />
2) Bestehen, was die Zeit vor und nach einem Klinikaufenthalt betrifft, i.d.R. keine<br />
Unterschiede in sozialen Variablen wie dem Beruf oder Beziehungen; sprich:<br />
die Patienten sind nachher nicht weniger angepasst als vorher!<br />
5.4.2. Sozioökonomischer Status<br />
Die Schizophrenierate ist in den untersten Sozial-Schichten (sprich: in Slums und<br />
Arbeitervierteln) am höchsten!<br />
Dazu gibt es 2 Erklärungen:<br />
1) Soziogenetische Hypothese („social stress“): Das Leben unter den<br />
schlechten Bedingungen ist eine Ursache der Krankheit (mehr Stress, mehr<br />
kritische Life-Events, schlechtere Ernährung, schlechtere medizinische<br />
Versorgung, weniger Bildung etc.)<br />
2) Social-Drift Hypothese („social selection“): Nicht die soziale Schicht<br />
bedingt die Krankheit, sondern die Krankheit die soziale Schicht. Schon<br />
im Vorfeld der akuten Krankheit driften Schizophrene aufgrund der<br />
Symptomatik der Promodalphase (Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug<br />
etc.) in die unterste Schicht ab.<br />
Die empirischen Daten sprechen eher für die Social-Drift Hypothese (man<br />
braucht sich dazu nur die Herkunftsfamilien der Schizophrenen anzuschauen,<br />
die in den meisten Fällen einen besseren sozioökonomischen Status innehaben)<br />
62