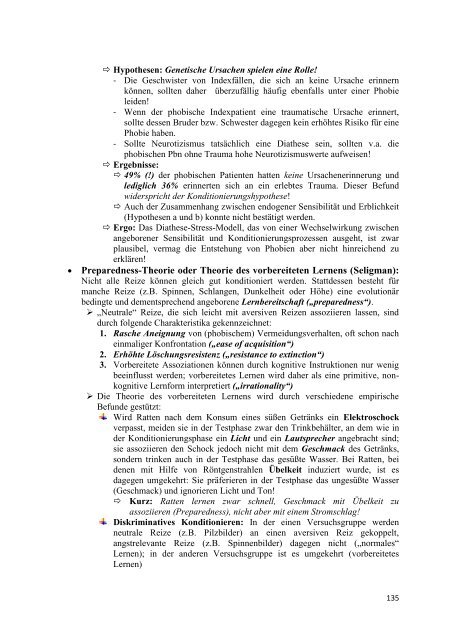KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hypothesen: Genetische Ursachen spielen eine Rolle!<br />
- Die Geschwister von Indexfällen, die sich an keine Ursache erinnern<br />
können, sollten daher überzufällig häufig ebenfalls unter einer Phobie<br />
leiden!<br />
- Wenn der phobische Indexpatient eine traumatische Ursache erinnert,<br />
sollte dessen Bruder bzw. Schwester dagegen kein erhöhtes Risiko für eine<br />
Phobie haben.<br />
- Sollte Neurotizismus tatsächlich eine Diathese sein, sollten v.a. die<br />
phobischen Pbn ohne Trauma hohe Neurotizismuswerte aufweisen!<br />
Ergebnisse:<br />
49% (!) der phobischen Patienten hatten keine Ursachenerinnerung und<br />
lediglich 36% erinnerten sich an ein erlebtes Trauma. Dieser Befund<br />
widerspricht der Konditionierungshypothese!<br />
Auch der Zusammenhang zwischen endogener Sensibilität und Erblichkeit<br />
(Hypothesen a und b) konnte nicht bestätigt werden.<br />
Ergo: Das Diathese-Stress-Modell, das von einer Wechselwirkung zwischen<br />
angeborener Sensibilität und Konditionierungsprozessen ausgeht, ist zwar<br />
plausibel, vermag die Entstehung von Phobien aber nicht hinreichend zu<br />
erklären!<br />
Preparedness-Theorie oder Theorie des vorbereiteten Lernens (Seligman):<br />
Nicht alle Reize können gleich gut konditioniert werden. Stattdessen besteht für<br />
manche Reize (z.B. Spinnen, Schlangen, Dunkelheit oder Höhe) eine evolutionär<br />
bedingte und dementsprechend angeborene Lernbereitschaft („preparedness“).<br />
„Neutrale“ Reize, die sich leicht mit aversiven Reizen assoziieren lassen, sind<br />
durch folgende Charakteristika gekennzeichnet:<br />
1. Rasche Aneignung von (phobischem) Vermeidungsverhalten, oft schon nach<br />
einmaliger Konfrontation („ease of acquisition“)<br />
2. Erhöhte Löschungsresistenz („resistance to extinction“)<br />
3. Vorbereitete Assoziationen können durch kognitive Instruktionen nur wenig<br />
beeinflusst werden; vorbereitetes Lernen wird daher als eine primitive, nonkognitive<br />
Lernform interpretiert („irrationality“)<br />
Die Theorie des vorbereiteten Lernens wird durch verschiedene empirische<br />
Befunde gestützt:<br />
Wird Ratten nach dem Konsum eines süßen Getränks ein Elektroschock<br />
verpasst, meiden sie in der Testphase zwar den Trinkbehälter, an dem wie in<br />
der Konditionierungsphase ein Licht und ein Lautsprecher angebracht sind;<br />
sie assoziieren den Schock jedoch nicht mit dem Geschmack des Getränks,<br />
sondern trinken auch in der Testphase das gesüßte Wasser. Bei Ratten, bei<br />
denen mit Hilfe von Röntgenstrahlen Übelkeit induziert wurde, ist es<br />
dagegen umgekehrt: Sie präferieren in der Testphase das ungesüßte Wasser<br />
(Geschmack) und ignorieren Licht und Ton!<br />
Kurz: Ratten lernen zwar schnell, Geschmack mit Übelkeit zu<br />
assoziieren (Preparedness), nicht aber mit einem Stromschlag!<br />
Diskriminatives Konditionieren: In der einen Versuchsgruppe werden<br />
neutrale Reize (z.B. Pilzbilder) an einen aversiven Reiz gekoppelt,<br />
angstrelevante Reize (z.B. Spinnenbilder) dagegen nicht („normales“<br />
Lernen); in der anderen Versuchsgruppe ist es umgekehrt (vorbereitetes<br />
Lernen)<br />
135